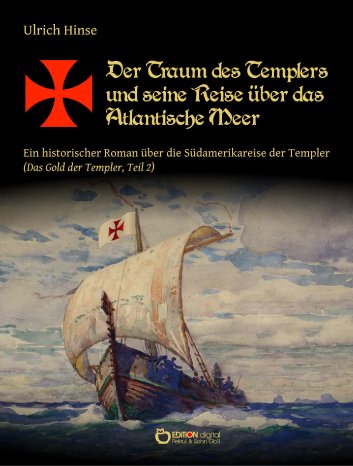Im Jahre 2000 erschien im Würzburger Arena Verlag unter dem Titel „Verfolgung durch die grüne Hölle“ das dritte Buch, in dem Jan Flieger die Haifisch-Bande auf Zeitreise schickt: Ihr aktueller Ausflug führt Julia und Vanessa, Long Basti und Specki von der Haifisch-Bande wieder mit Hilfe der Zeitkugel von Old Krusemann, dem alten Seebären, zu den Maya. Eine große Maya-Ausstellung im Stadtmuseum hatte ihre Aufmerksamkeit geweckt. Noch neugieriger aber waren sie geworden, als sie in der Ausstellung erfuhren, dass es sich bei der dort in einem Film gezeigten Skulptur des berühmten Regengottes Chac um eine Fälschung handelt. Aber wo ist das Original? Natürlich wollen es Julia und Vanessa, Long Basti und Specki finden und fliegen wieder durch die Zeiten zu den Maya. Tatsächlich finden sie dort die gesuchte Skulptur, kommen aber auch wieder in allergrößte Schwierigkeiten …
Und so bereitet sich die Haifisch-Band auf ihren Ausflug durch die Zeiten vor, der natürlich wieder nur mit Hilfe von Old Krusemann und seiner Zeitkugel gelingen kann. Aber der alte Seebär hat eine Bitte: „Julia nickt zögernd und Long Bastis Antwort wartet Vanessa erst gar nicht ab. Sie rennt voraus, an der Skylandbrücke vorbei, durch die Straßen der Altstadt, immer den rot und weiß gestrichenen Leuchtturm vor Augen, der an der Spitze der Halbinsel steht, auf der sich auch Old Krusemanns Waggon befindet. Der alte Seebär wohnt nämlich nicht in einem Haus, sondern in einem alten Eisenbahnwaggon, den er leuchtend blau gestrichen hat, mit rotem Dach und weißen Fensterläden. Auf dem rostigen alten Anker vor dem Waggon hocken wie immer die Möwen. Einige fressen Old Krusemann sogar aus der Hand.
Als die Kinder hereinstürmen, hockt Old Krusemann gerade an dem Tisch mit der Muschelplatte und bastelt an einem Flaschenschiff. Es riecht gewaltig nach Fisch in dem engen Raum. Wie in einer Fischfabrik. Julia verzieht das Gesicht. Vanessa gibt Old Krusemann einen Kuss auf die Wange. Dann zeigt sie ihm die Postkarte. „Da wollen wir hin!“ „Aber das ist ja ein Gemälde!“, wendet Old Krusemann ein. „Gibt es die Gegend denn überhaupt? Sonst weiß ich nicht, ob das überhaupt klappt.“ „Natürlich klappt das!“, behauptet Specki. „Auf jeden Fall finden wir das Bild toll“, ergänzt Julia vorsichtig. Aber da Julia immer übervorsichtig und sogar etwas ängstlich ist, klingt dieser Satz für die anderen geradezu nach wilder Entschlossenheit. „Wir wollen da unbedingt hin, zu den Geisterruinen im Dschungel“, bekräftigt Long Basti.
Old Krusemann seufzt. „Wenn das man gut geht!“, brummt er. „Ihr werdet auf jeden Fall mehr Zeug mitnehmen müssen als beim letzten Mal. Zum Beispiel eine Machete, damit ihr euch im Urwald den Weg bahnen könnt. Ich hab da noch eine in meiner Seemannskiste. Die muss ich nur schärfen.“ „Und wenn wir alles zusammenhaben, versuchen wir’s?“, drängt Vanessa. Old Krusemann nickt nur. „Ja, min Deern!“ „Ich bin Vanessa“, grollt Vanessa leise. „Jaja, min Deern.“ Specki blickt Vanessa an und legt den Finger auf den Mund. Sie muss doch endlich mal begreifen, dass Old Krusemann zu jedem Mädchen „min Deern“ sagt. Genau so, wie er jeden Jungen mit „min Jong“ anredet. „Ihr müsst Tabletten gegen Malaria schlucken“, rät Old Krusemann. „Sonst seid ihr nachher krank. Malariatabletten habe ich auch noch irgendwo. Am besten, ich gebe sie euch gleich.“ „Klaro“, versichert Vanessa. Old Krusemann kramt in einem Schrank aus Treibholz und gibt jedem der vier eine Tablette. Dann spendiert er eine Cola. „Jeder einen Schluck und die Tablette ist runter.“
Dann besprechen die Kinder mit Old Krusemann, was sie alles auf die Reise mitnehmen. „Auf jeden Fall einen guten Fotoapparat und eine kleine Kamera“, meint Specki. „Wenn wir interessante Funde machen, müssen wir sie doch für die Nachwelt - äh, also für die Gegenwart festhalten.“ „Auf keinen Fall!“, fährt Old Krusemann auf. „Selbst wenn ihr einen solchen Ort findet, dürft ihr nie von ihm erzählen! Denn man wird euch fragen, wie ihr dorthin gekommen seid, zu den Maya-Ruinen. Und das will ich nicht! Die Kugel muss ein Geheimnis bleiben. Für immer!“
Ein bisschen mehr als zwei Jahrzehnte früher hatte Christa Grasmeyer im Verlag Neues Leben Berlin ihr Buch „Der unerwünschte Dritte“ veröffentlicht: Die Opernsängerin Edda Schumann aus Schwerin adoptiert Dörte als Baby und holt nach zwei Jahren noch die 12-jährige Sophie aus dem Heim, die sich daran gewöhnt hat, mit dem Verlust liebgewordener Menschen fertig zu werden. Mit viel Liebe und Geduld werden alle drei eine glückliche Familie. Und dann ist da noch Bodo und die erste Liebe der inzwischen 15-jährigen Dörte. Alles könnte so schön sein, wenn die Mutter nicht den 10-jährigen Peter aus dem Heim geholt hätte. Die Katze hat er getötet, die Fische vergiftet, er stört einfach. Und doch sucht Sophie verzweifelt eine lange Nacht hindurch den davongelaufenen Jungen, den sie vergrault hat. Schuld quält ihr Gewissen. Wenn wenigstens Bodo bei ihr wäre, aber der will seine Ruhe haben.
Auch in dem folgenden kleinen Ausschnitt aus diesem Buch gibt es offenbar ein Problem mit Peter: „Dörte war mit den Hausaufgaben fast fertig, da hörte ich, dass Peter kam. Allerdings war ich einen Moment lang nicht ganz sicher, ob es Peter wirklich war. Kein Türenknallen, kein Poltern und Stampfen kündigte ihn an, sondern ein merkwürdig gedämpftes Einschnappen des Schlosses und ein leises Schurren. Aber als ich auf den Flur trat, sah ich ihn. Er stand, die Gummistiefel in der Hand, und griente mich an, lauernd, wie mir schien, jedenfalls nicht so frech wie sonst. Er behielt mich im Auge, während er vorsichtig die Stiefel abstellte, in seiner Hosentasche grabbelte und mir eine Handvoll schmieriger Kaubonbons hinstreckte.
Diese erbärmliche, anbiedernde Geste brachte die Wut in mir zum Überkochen. Ich schlug ihm die Kaubonbons aus der Hand, packte ihn und zerrte ihn ins Zimmer vor das Aquarium. „Da, guck hin und freu dich! Es ist dir gelungen, sie sind alle tot.“ Er hatte zunächst keinen Widerstand geleistet. Nun begann er sich zu wehren und schrie: „"Das war ich nicht!“ „Wer sonst hat den Essig ins Wasser gegossen, meine Mutter etwa?“ Er stutzte. Er hatte wohl nicht erwartet, dass ich so schnell herausfinden würde, wodurch die Fische gestorben waren. Trotzdem leugnete er weiter. Dass er mal ehrlich etwas zugab, hatte ich noch nie erlebt.
„Aus Versehen!“, plärrte er. „Ich hab's nicht gewollt, bloß aus Versehen ist der Essig reingekippt!“ „Dann hat sich hier also ein Naturwunder ereignet. Die Flasche kam aus der Küche herbeigeflogen.“ „Ich wollte trinken und hab die Flaschen verwechselt und vor Schreck den Essig verschüttet ...“
Ich schlug ihm ins Gesicht. „Für wie dumm hältst du mich?“ Er krallte sich an meinen Armen fest. Ich fühlte, dass er Angst hatte, dadurch wuchsen seine Kräfte. Wir kämpften miteinander, bis er sich losriss und in die Ecke bei der Tür stürzte. Dort eingeklemmt, bezog er die ihm eigene Verteidigungsstellung, beide Arme über den Kopf gelegt, ein Bein stoßbereit vorgestemmt. Meine Mutter hatte gesagt, diese Reflexbewegung habe er wahrscheinlich schon als ganz kleines Kind gelernt, es sei ein schlimmes Zeichen. Das fand ich auch, ein Zeichen nämlich für seine feige Natur. Er selber hatte keine Bedenken, Schwächere zu schlagen. Aber sobald es ihm an den Kragen ging, verschanzte er sich, und dann kam man kaum an ihn heran, ohne gestoßen, gebissen und gekratzt zu werden. Mit aller Gewalt riss ich ihm die Arme herunter, so dass er sich erneut festkrallen musste, um mich am Schlagen zu hindern. Irgendwie gelang es ihm, er kam von mir los und stürzte in sein Zimmer. Gerade noch rechtzeitig klemmte ich den Fuß zwischen die Tür. Er kroch unters Bett. Ich lief in die Küche und ergriff den Besen. Als ich zurückkehrte, sah ich Peter unter dem Bett hervorspähen. Ich stieß mit dem Besenstiel nach ihm. Blind vor Zorn stocherte ich und rammte den Stiel in die hintersten Ecken, egal, wie und wo ich Peter traf. Er wimmerte leise.“
Noch einmal ein knappes halbes Jahrzehnt früher hatte Rainer Hohberg in seinem im Gebr. Knabe Verlag Weimar veröffentlichten Buch „Der Junge aus Eisenach“ zu einer Begegnung mit Johann Sebastian Bach eingeladen: Wer war Johann Sebastian Bach? Wo und vor allem wie hat der heute weltberühmte Komponist gelebt? Fragen über Fragen, die sich die Schulklasse 7b aus Tannenstein stellt, deren Schule nur knapp 50 Kilometer entfernt von Eisenach steht – der Geburtsstadt von Bach. Der Ausgangspunkt der Rahmenhandlung, die nicht zuletzt einen Blick in das DDR-Schul- und Pionierleben Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erlaubt, ist ein sehr erfreulicher – die talentierte Katja hat beim Bezirksausscheid Junger Talente im Fach Klavier den 1. Platz belegt. Aber trotz dieses Erfolges kann die Klasse im Wettbewerb um den Wanderwimpel noch nicht so recht mithalten. Dann aber haben die Pioniere eine Idee und wollen in einem Forschungsauftrag das Leben des großen Komponisten erkunden und ein Programm und eine Wandzeitung zu Bach gestalten. Dazu fahren sie an ihrem Wandertag sogar nach Eisenach ins Bachhaus – entgegen dem Vorschlag, lieber den Erfurter Zoo zu besuchen. Auf diese Weise erfahren die Tannensteiner Schüler und mit ihnen die jungen Leser viel Interessantes und Wissenswertes aus dem Leben und Wirken von Johann Sebastian Bach als kleinem Jungen, der unbedingt Orgel spielen wollte, über seine Zeit als Organist in Arnstadt und seinen langen Besuch bei Buxtehude in Lübeck, aber auch über einen Arrest des Hofmusikers in Weimar und über sein Wirken als Thomaskantor in Leipzig. So entsteht ein farbiges Bild des Musikers und Menschen Bach.
Der 1975 in der Reihe „Knabes Jugendbücherei“ erschienene „Junge aus Eisenach“ war die erste größere literarische Arbeit des Autors Rainer Hohberg. Geschrieben hatte er es als Einundzwanzigjähriger und darin eigene Erlebnisse verarbeitet. In Eisenach geboren, besuchte Hohberg dort mehrere Jahre eine Schule, in der einst auch Johann Sebastian Bach gelernt hatte. Die gebührende gesellschaftliche Aufmerksamkeit sei dem genialen Tonsetzer jedoch kaum zuteil geworden, wie Hohberg fand. Viele Kinder und Jugendliche kannten nicht einmal seinen Namen. Diesem Umstand wollte er seine Geschichten entgegensetzen. „Der Junge aus Eisenach“ erlebte fünf Auflagen und fand zahlreiche interessierte Leser. Und so geht die Geschichte los – zunächst noch ganz ohne Johann Sebastian: „Es war freitags in der letzten Unterrichtsstunde. Die Zeit tröpfelte langsam dahin. K-Wagen-Schleßinger, unser Musiklehrer, hatte bisher ununterbrochen geredet, hatte die Tafel mit Noten und anderen Zeichen vollgeschrieben, um uns den Unterschied zwischen Dur und Moll beizubringen. Herr Schleßinger war eigentlich Lehrer für den Unterrichtstag in der Produktion. Als K-Wagen-Konstrukteur und Leiter der erfolgreichen K-Wagen-Mannschaft unserer Schule hatte er unserem Ort Tannenstein und sich selbst einen Namen gemacht, den man im ganzen Bezirk kannte. Aber auch für den Musikunterricht kamen ihm seine technischen Fähigkeiten zustatten. An dem alten, schwarzen Konzertflügel, der in der linken Ecke des Musikkabinetts stand, war von ihm ein großes Vorhängeschloss angebracht worden, da man das eingebaute Schloss demoliert hatte. So konnten die Schüler in den Pausen nicht mehr darauf herumklimpern und das Instrument verstimmen. Aber leider war K-Wagen-Schleßinger etwas vergesslich. In jeder Musikstunde musste er uns die traurige Mitteilung machen, dass er den Schlüssel für den Flügel wieder vergessen habe und uns deshalb leider, leider nichts vorspielen könne. Die Sommersonne schien durch die geöffneten Fenster auf neunundzwanzig müde Schülergesichter. Sie lachte geradezu, und es war mir, als ob sie uns auslachte. Ich starrte in den blauen Himmel und kaute an einem schwierigen Gedanken herum. Ich versuchte mir vorzustellen, was passieren würde, wenn man mit einer Rakete in dieses Blau hineinfliegen könnte und immer geradeaus weiter. An ein Ende kommt man nicht. Das wusste ich von meinem Bruder. Aber ...
„Rödinger, komm vor!“, donnerte Herr Schleßinger unerwartet los. Ich schreckte hoch, denn Rödinger, das war ich. Schleßinger sah man die Genugtuung an, mich aus meinen Gedanken geschreckt zu haben. „Erläutere mal bitte“, forderte er in einem gefährlich freundlichen Ton, „worin der Unterschied zwischen Dur und Moll besteht.“ Um die Zeit zum Überlegen zu gewinnen, ging ich langsam um die hintere Bank herum nach vorn zur Tafel. Das fasste Herr Schleßinger anscheinend als Provokation auf. Mir war trotz des Umweges nichts eingefallen. Ich stand da und schwieg. Er kam mit großen Schritten auf mich zu, postierte sich so nahe vor mir, dass ich den Zigarettenqualm aus seinem Anzug riechen konnte, und presste wütend zwischen seinen Zähnen hervor: „Rödinger, du alte Nachtmütze, dir werde ich ...“ Es mag Menschen geben, denen es nichts ausmacht, wenn ihnen so etwas gesagt wird. Ich werde diese Beschimpfung wohl in meinem ganzen Leben nicht wieder vergessen. In der Klasse murrten einige. Stühle knarrten. Die Unruhe wurde stärker. Ich ging langsam zu meinem Platz zurück. Den Rest der Stunde saß ich da wie gelähmt und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schleßinger nahm Katja dran. Unsere Katja war beim Kreisausscheid Junger Talente als beste Klavierspielerin ausgezeichnet worden. Sie wusste alles: „Dur und Moll sind unsere wichtigsten Tongeschlechter. Je nachdem, was für Intervalle die einzelnen Töne einer Tonleiter im Vergleich zum Grundton bilden, sprechen wir von Dur- oder Moll-Tonleitern. Große Terz in Dur - kleine Terz in Moll. Große Sext in Dur - kleine Sext in Moll ...“
Ich verstand nur Bahnhof. Rote und schwarze Ringe tanzten vor meinen Augen. Mir wurde schwindlig. Während Katja sprach, schaute sie nicht Schleßinger, sondern mich an. Mit ihren großen, dunkelbraunen Augen, mitleidig. Soweit war es mit mir also schon gekommen.“
Die nächsten drei Angebote sind alles Eigenproduktionen der EDITION digital, welche sie jeweils sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Books herausgebracht hat. 2015 erschien auf diese Weise „Der Traum des Templers und seine Reise über das Atlantische Meer. Ein historischer Roman über die Südamerikareise der Templer“ von Ulrich Hinse: Joao Lourenço, ein Templer, der als Johann Laurenz in der Nähe von Aachen groß wurde, hatte im Auftrag des Großmeisters Jaques de Molay einen Teil des Templervermögens nach Portugal gebracht. Mit Vertrauten des König Dionysius gelingt es, den in vielen christlichen Ländern verfolgten Templern eine neue Heimat in Portugal zu sichern und sie als Orden der Christusritter zu etablieren. Von dem Bischof von Lamego hört Joao, dass in Córdoba muslimische und jüdische Gelehrte Astronomie, Geografie und Kartenzeichnen unterrichten. Das interessiert ihn und er studiert die für Christen neuen Wissenschaften. Er kommt zu der Überzeugung, dass die Erde keine Scheibe, sondern eine Kugel und auch Jerusalem nicht der Nabel der Welt ist, wie es die christlichen Mönche vermittelten. Er ist sicher, dass hinter dem Horizont des Atlantischen Meeres im Westen noch anderes Land liegen muss. Joao träumt davon, dorthin zu fahren. Er erwirbt ein schnelles Templerschiff, lässt es durch Handwerker des Ordens umbauen und wirbt Templerbrüder an, die mit ihm ins Unbekannte fahren wollen. Joao Lourenço findet das von Jan van Koninck (siehe dazu das Buch „Das Gold der Templer“) versteckte Gold und finanziert damit die Umsetzung seines Traums. Mit den herbstlichen Passatwinden fahren sie übers Meer nach Westen. Ein Roman aus der Zeit des tiefsten Mittelalters mit ehrenhaften Rittern, dogmatischen Klerikern, gelehrten Muslimen und erfinderischen Juden. Und natürlich mit fiesen Schurken.
Aber beschäftigten wir uns zunächst einmal kurz mit der Hauptfigur und schauen in das erste Kapitel des historischen Romans: „Joao Lourenço war Tempelritter. Und er stellte etwas dar. Und das wusste er auch. Sein Selbstbewusstsein war groß, aber nicht so überzogen, dass er arrogant gewirkt hätte. Eigentlich hieß der große, kräftige, junge Mann gar nicht Joao Lourenço, sondern mit richtigem Namen Johann Laurenz, war Sohn eines angesehenen Kaufmanns und stammte aus der Nähe von Aachen. Er hatte sich im Zorn von seinem Elternhaus getrennt, war nach Paris gelangt und hatte dort zu den Templern gefunden, wo er zunächst bei dem Präzeptor Gerard de Villars als Knappe gedient hatte. Der Ritter hatte seine Gewandtheit und seine Intelligenz erkannt und so war er zum Ritter aufgestiegen und zusammen mit dem Flamen Jan van Koninck in den Orden aufgenommen worden. Mit Jan hatte er sich verbunden gefühlt, weil der ein ähnliches Schicksal erlitten hatte. Joao war bei den anderen Rittern beliebt, wegen seiner Umsichtigkeit geachtet und wegen seiner Körperkraft und Geschicklichkeit im Umgang mit den verschiedensten Waffen gefürchtet. Nicht zuletzt deshalb hatte Jaques de Molay, der Großmeister des Templerordens, den dunkelblonden Mann mit den ebenmäßigen Gesichtszügen aus dem kleinen Ort Heristal nahe Aix la Chapelle zu einem der Männer bestellt, die den Schatz der Templer in Sicherheit bringen sollten. Joao war knapp dreißig Jahre alt und deutlich größer als die meisten Männer seiner Zeit. Er überragte sie um mehr als eine Haupteslänge. Stolz trug er den weißen Mantel mit dem leuchtendroten Kreuz auf der Brust, den er erst vor gut einem Jahr von Jaques de Molay verliehen bekommen hatte, als er in den Orden aufgenommen worden war.
Unter dem Mantel war das Kettenhemd zu erkennen und sein kräftiges, dunkelblondes, langes Haar wurde durch die Kapuze des Kettenhemdes verdeckt. Das Schwert an seiner linken Seite wurde nur unzureichend von dem Mantel verhüllt. Sein Gesicht war offen und wurde, anders als bei den meisten Tempelrittern, von einem gekräuselten Vollbart umrahmt. Er erschien allen, die mit ihm zu tun hatten, als ein freundlicher Mensch. Keiner hatte das Gefühl, sich vor ihm fürchten zu müssen. Wenn es aber sein musste, war er ein unerbittlicher, ja gelegentlich gnadenloser Streiter für den Glauben und seinen Orden. Es hatte ihm wehgetan, als er von Jaques de Molay von der bevorstehenden Verhaftung aller Templer in Frankreich in Kenntnis gesetzt wurde. Geehrt hatte ihn das Vertrauen seines Großmeisters, der ihn als Vertreter des Ritters Gerard de Villars einsetzte. De Villars wurde beauftragt, einen Teil des riesigen Ordensvermögens vor dem Zugriff des französischen Königs zu retten. Mit Schiffen des Ordens, die im Hafen der Stadt La Rochelle lagen, sollten sie nach Süden fahren. Das genaue Ziel kannte nur de Villars. Sein Freund Jan van Koninck, ein Ritter aus Flandern, der mit ihm zusammen im Temple de Paris ausgebildet und in die Reihen der Tempelritter aufgenommen worden war, sollte mit einem Wagenzug nach Kastilien und weiter zur Templerfestung Ponferrada. Ein weiterer Wagenzug der Templer sollte von der Kanalküste nach England übersetzen, um sich dort in Sicherheit vor ihren Verfolgern zu bringen.
Knapp ein Jahr war vergangen, als sie sich von Paris aus in Bewegung gesetzt hatten. Nahe Orleans hatten sich die Wagenzüge getrennt. Villars und er waren Richtung La Rochelle weitergezogen, während Guido de Voisius und Jan van Koninck in Richtung der alten Westgotenresidenz Rennes le Chateau weitergefahren waren. Überraschend hatten sie sich im Sommer, der auf die Verhaftungen folgte, in der Templerfestung Ponferrada im iberischen Königreich Kastilien y Leon wiedergetroffen. De Villars hatte die Templerschiffe in einem kleinen Hafen in Asturien entladen lassen, um sie dann mit ihren Mannschaften nach, wer weiß wohin, zu entlassen. De Villars hatte Joao die Fracht und das Kommando übergeben und wollte allein auf dem Landweg nach Barcelona und von dort weiter zu den Ordensbrüdern nach Mallorca. Joao hatte sich für Portugal entschieden. Warum, wusste er nicht. Es war nur so ein Gefühl gewesen. Jetzt stand Joao Lourenço in einer kleinen Kirche in Galiziens Bergen gut eine Tagesreise südlich von Ponferrada und ebenso weit von der portugiesischen Grenze nördlich Bragança entfernt. Tränen rannen seine Wangen hinunter. Am Altar stand ein Mönch, der vor den Tempelrittern eine Totenmesse zelebrierte.
Vor einer halben Stunde hatten sie vor dem Portal der kleinen Kirche seinen Freund Jan van Koninck beerdigt. Er war im Kampf gegen Söldner des französischen Königs, die ihn verfolgt hatten, um ihm das Gold der Templer abzunehmen, schwer verwundet worden. Die Hilfe durch Joao und seine Männer war eine halbe Stunde zu spät eingetroffen. Joao hatte zwar die Söldner niedergemacht, aber seine Ordensbrüder konnten nicht mehr gerettet werden. Jan hatten sie schwer verletzt vom Schlachtfeld geborgen und zu einem nicht weit entfernten Kloster gebracht. Aber die Mönche konnten auch nichts mehr für ihn tun. Auf seinen Wunsch hin hatten sie Jan von Koninck nach Santiago de la Requejada getragen, wo er vor dem Portal der kleinen Kirche bestattet werden wollte. Joao hatte sich zwar gewundert, aber der Wunsch seines Freundes war ihm Befehl gewesen. Der Abt hatte ihnen einen seiner Mönche als Wegkundigen mitgegeben, der auch die Totenmesse zelebrieren sollte. Und so waren Joao und seine Mannen den mühsamen Weg hinauf in die Berge geritten und an der kleinen, verlassenen Kirche angekommen. Verwundert hatte sich Joao umgesehen. Der Ort war ganz offensichtlich unbewohnt, die Häuser von allen Menschen verlassen. Einige wenige Ziegen grasten in der Nähe und ließen vermuten, dass Hirten anwesend waren. Zu sehen waren sie nicht. Seltsam war, dass genau hier in dieser Einöde Jan van Koninck hatte begraben werden wollen.“
Ebenfalls 2015 veröffentlichte Brigitte Rabeler bei der EDITION digital das Buch „Stolperjahre“: Felix, ein kleiner dickbäuchiger, aber in Mathematik begabter Junge lebt mit seiner Mutter allein. Seine Freunde sind der Opa, der ihm oft den fehlenden Vater ersetzen muss und Peter, ein begeisterter Fußballspieler. Durch seine Naschhaftigkeit, die auch vor fremden Türen nicht Halt macht, gefährdet er die Freundschaft mit Peter und gerät durch Ausreden in immer tiefere Konflikte. Da hilft ihm auch kein Kobold, der ihn nachts in seinen Träumen aufsucht. Auch die Erfüllung seines größten Wunsches, einen Vater zu bekommen, gerät ins Wanken, da dieser das Fußballidol seines besten Freundes ist.
Wir lernen Felix gleich kennen – auch wenn das erste Kapitel des Buches fast wie ein Märchen anfängt, fast wie ein Märchen, wie auch die Autorin zugibt: „Es war einmal ein Junge. Ja, mit „es war einmal“, so fangen fast alle Märchen an. Aber dieses ist kein Märchen. Es geschah erst vor Kurzem und ganz in deiner Nähe in einem kleinen Städtchen am Rande eines großen Fußballfeldes. Also, noch einmal. Es war einmal ein Junge, der hieß Felix, Felix Kuhlbaum. An einem warmen Herbsttag saßen also der fünfjährige Felix und sein Opa Kurt auf dem Steg am See und ließen die Beine baumeln. Felix‘ Beine waren noch zu kurz, um in das kühle Nass einzutauchen. Darum spritzte Opa Kurt mit seinen großen Füßen dem Kleinen das Wasser auf die Beine. Das fand Felix spaßig und er jauchzte vor Vergnügen. Felix war gern bei Opa Kurt. Er konnte herrliche Seemannsgeschichten erzählen, aber auf großer Fahrt war er noch nie gewesen. Vor allem aber konnte er Fische fangen, denn er war Fischer.
Bei Opa Kurt war es stets interessant. Überall gab es was zu entdecken oder zu beobachten. Und wenn Opa mal keine Zeit hatte, spielte er mit der vierjährigen Daysi, der schwarz-braun gefärbten Schäferhündin. Leider konnte Felix immer nur zum Opa, wenn dieser Zeit für ihn hatte. Das aber kam drei- bis viermal im Jahr vor. Ein altes Bauernhaus mit Scheune, das Opa Kurt von seinen Eltern geerbt hatte, ein kleiner Garten, und was das Beste war, ein Motorboot nannte er sein eigen. Zwar war das Boot nur ein Ruderkahn mit Außenbordmotor. Das aber war Felix vollkommen schnuppe. Viel zu gern fuhr er mit Opa Kurt an den Schilfgürtel, wo sie gemeinsam die Angeln auswarfen.
In die Scheune und in den Schuppen durfte Felix nicht alleine gehen. Opa Kurt ermahnte ihn immer wieder, dass es zu gefährlich sei, da dort allerlei scharfes Werkzeug aufbewahrt wurde. Beim letzten Besuch hatten sie im Stroh ein Kätzchen entdeckt, das ihre Jungen gerade geworfen hatte. Felix war jeden Tag hingegangen, hatte sich in eine Ecke gesetzt, die Opa ihm zugewiesen hatte und die Kätzchen beobachtet. Diesen Herbst wollte Opa Kurt ihm zeigen, wie man ein kleines Segelboot bauen kann. Auch wollte er mit Felix Drachen steigen lassen. Darauf freute sich Felix schon sehr. Eigentlich war er ganz froh, als Opa Kurt anrief und sagte, dass er einige Tage zu Hause wäre und Felix zu ihm kommen könnte. Es waren doch Herbstferien, und der Hort, wie auch der Kindergarten, blieben für eine Woche geschlossen. Beide waren unter einem Dach, weil sonst die größeren schulpflichtigen Kinder nach der Schule ein Dorf weiter fahren müssten, um betreut zu werden. Außerdem hatte er keine Lust, mit den anderen draußen zu spielen. Sie hatten ihn mal wieder geärgert. Sein kleiner runder Bauch war oft genug Anlass zu Spötteleien. Er naschte ja auch viel zu gerne. Und besonders Kühlschränke hatten es ihm angetan. In ihm waren oft so wunderbare Speisen zu sehen, dass er immer etwas herausnahm und in den Mund steckte.
Dieses Mal war es aber etwas anderes. Als seine Horterzieherin Frau Speck am letzten Tag vor den Ferien alle Kinder fragte, wo sie in den Ferien bleiben werden, hatte Felix geantwortet, dass er wieder zu Opa Kurt fährt. Sein Opa war erst 49 Jahre und ein sehr gut aussehender Mann mit einem kleinen Schnauzer. Einmal hatte er Felix vom Kindergarten abgeholt und mit der Erzieherin geflirtet. Das hatten natürlich die größeren Kinder mitbekommen. Seitdem lästerten sie, wenn Felix zum Opa fuhr. Sie meinten, Felix wäre seine Ersatzfreundin oder auch Lückenbüßer. Felix konnte zwar nicht viel mit den versteckten Anspielungen anfangen, war aber immer sehr verletzt.“
Nicht um einen Jungen, sondern um ein Mädchen geht es in dem 2016 bei der EDITION digital auch wieder sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book erschienenen Buch „Nadja Kirchner und die Raben aus der geheimnisvollen Senke“ von Johan Nerholz: Ein zwölfjähriges Mädchen, das keine Eltern mehr hat, wächst in einem Dorf bei ihren Großeltern auf. Auch wegen ihrer guten Leistungen in der Schule wird die kleine und stille Nadja von anderen Jungen aus dem Dorf angefeindet und sogar angegriffen. Doch niemand scheint ihr zu helfen. Da findet sie eines Tages einen jungen Raben, den sie mit nach Hause bringt. Gemeinsam mit ihren Großeltern pflegt sie ihn gesund. Und dann wird das Tier offensichtlich von seinen Raben-Eltern abgeholt. Einer der beiden Raben ist riesig. Als Nadja kurze Zeit später wieder von einigen Jungen angegriffen wird, kommen ihr die Raben zu Hilfe und vertreiben die Angreifer. Kurz darauf wird Nadja in die Senke gelockt, die früher mal ein kleiner See war und die schon lange kein Mensch mehr betreten konnte. Dort gibt sich ihr der riesige Rabe Rontur zu erkennen. Er ist der Anführer der Raben und kann sprechen.
Ab sofort steht das Mädchen unter dem Schutz dieser Vögel. Und Nadja lernt sich zu wehren, auch mit übernatürlichen Mitteln. Die braucht sie aber auch, da das Mädchen von übernatürlichen Gestalten angegriffen wird. Zu ihrem Schutz wird der riesige ehemalige Dämonenhund Takesch abgestellt. In diesem Zusammenhang lernt Nadja auch eine ihr bisher unbekannte Seite ihrer bei einem mysteriösen Autounfall getöteten Mutter Manuela kennen. Sie war einst Bannherrin des Sees gewesen und hatte damit auch für den Schutz der Raben gesorgt. Und der Dämonenhund Takesch war damals Beschützer ihrer Mutter. Im weiteren Verlauf der Handlung, die mehr und mehr zwischen der Wirklichkeit und dem Reich der Fantasy changiert, muss sich Nadja auch noch ganz anderer Feinde erwehren, und sie lernt Dinge kennen und beherrschen, die kein Mensch leisten kann. Schließlich kommt es zu einem alles entscheidenden Kampf. Und Nadja trifft eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Das spannend und geheimnisvoll erzählte literarische Debüt wurde für Kinder ab 10 Jahre geschrieben. Aber schauen wir mal, was bei einem Orkan in dem Dorf passiert, wo das Mädchen aufwächst. Und achten Sie bitte genau auf den Schluss dieses Ausschnitts:
„Nicht weit von dem Ort entfernt, wo die unterirdische Feier stattgefunden hatte, befand sich ein abgelegenes Dorf. Dieser Ort war von Ackerflächen umgeben. So wirkte er wie eine einsame Insel zwischen den Feldern. In der Dorfmitte stand eine denkmalgeschützte Feldsteinkirche. Die Anzahl der Häuser war übersichtlich. Die Kirche wurde von einer hohen Friedhofsmauer, die ebenfalls aus Feldsteinen bestand, umsäumt. Diese Steine waren Findlinge, die vor langer Zeit durch die Eiszeit hierher gebracht und nutzbringend verwertet wurden. Feldsteine gab es in dieser Gegend in Hülle und Fülle. Immer wieder mussten die Steine von den Feldern abgesammelt werden, sonst könnte es bei der Ernte für die Mähdrescher gefährlich werden. Kirche und Friedhofsmauer wurden kürzlich fachgerecht instandgesetzt und so boten beide zusammen ein schönes Bild im Dorfzentrum, um das die Bewohner des Dorfes von vielen Menschen aus der Umgebung beneidet wurden. Dass diese Instandsetzung durchgeführt werden konnte, war der Initiative einzelner Dorfbewohner zu verdanken. Sie unternahmen erfolgreich etwas gegen den Zerfall der Dorfmitte und sammelten Spendengelder von verschiedenen Stiftungen ein. Ein einsames Wohnhaus aus roten Backsteinen stand am Dorfende. Zu dem ummauerten Gehöft gehörte auch eine aus Feldsteinen errichtete Scheune, die gigantische Ausmaße hatte. In sie hatte man Ställe, Schuppen und Garagen integriert. Dennoch war noch genügend Platz vorhanden. Die asphaltierte Straße, die zu dem Haus führte, endete hier und mündete in einen Feldweg ein. An dem entgegengesetzten Ende des Dorfes befand sich ein großes Gut. Das wurde vor Jahren von einem Mann gekauft, der allen im Ort erzählte, er sei ein Graf, egal ob die Leute das hören wollten oder nicht. In diesem Teil von Deutschland war es wieder möglich, Gutshäuser und Schlösser zu erwerben.
Der Name des neuen Besitzers ließ darauf schließen, dass das, was er den Leuten erzählte, stimmte. Woher er kam, wusste keiner. Wenn ihn jemand darauf ansprach, schien er gezielt mit Nebelbomben zu werfen. Das, was man herausbekam, ließ vermuten, dass er schon in vielen Gegenden der Welt gewesen war. Er sprach verschiedene Sprachen fließend, wie seine engsten Mitarbeiter feststellten. Die Straße endete genau am Eingangstor des Gutshofes, der, wie das Gutshaus, riesig war. Die Straße, die aus dem Ort heraus führte, begann in der Dorfmitte. Sie stieß rechtwinklig auf die Dorfstraße. Hier befanden sich die Bushaltestelle mit der Wendeschleife sowie der Briefkasten.
Die Erben des Gutes wollten das große Anwesen nicht mehr haben, weil sie die dazugehörigen landwirtschaftlichen Flächen, die das ganze Dorf umschlossen, nach der deutschen Vereinigung nicht wiederbekamen. Sie wollten oder konnten diese Flächen nicht kaufen. Die Ackerflächen hatte der neue Gutsbesitzer von der Treuhandgesellschaft gleich mit erworben und betrieb jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er hatte sich auf Ackerbaukulturen wie Mais, Raps und Getreide spezialisiert. Einige Leute hatten Arbeit bei ihm gefunden, wenn auch nur in der Saison, in der die Kulturen gepflegt und geerntet wurden. War dies geschehen, wurden die Arbeitskräfte noch für die Aussaat benötigt. Dann mussten sie auf das nächste Frühjahr warten. Tiere gab es auf dem Gut nicht.
Die Dorfbewohner, die sonst noch Arbeit hatten, mussten das Dorf verlassen und weit fahren, um ihre Arbeitsstelle zu erreichen. Die regionale Arbeitslosigkeit war hoch. Es war nicht absehbar, dass es irgendwann hier weniger Arbeitslose geben würde. Zu viele Arbeitsplätze brachen in der Vergangenheit weg und neue entstanden nicht. Von einem großen Investor träumte hier keiner mehr. Darum nahm man die weiten Wege zur Arbeit in Kauf. Hier lebte man nur noch, weil man Eigentum hatte. Viele Menschen waren abgewandert. Diesen Trend gab es schon lange und der würde wohl noch weitergehen. Eine Umkehrung des Trends war nicht einmal ansatzweise erkennbar und das, obwohl die Vertreter der Politik nicht aufhörten zu erzählen, dass sie alles taten, um die Abwanderung zu stoppen. Es setzte langsam, aber stetig, eine Überalterung der Bevölkerung ein.
Ansonsten gab es in dem Dorf nichts weiter. Der Kindergarten war seit Jahren geschlossen. Eltern, die noch Kinder in dem Alter hatten, mussten in den nächsten Ort fahren, wo noch einer existierte. Der einstige Dorfladen hatte dichtgemacht. Die Frau, der auch das Haus gehörte, hatte das Rentenalter erreicht. Ein Nachfolger fand sich nicht. Der Laden rentierte sich nicht mehr. Wenn man einkaufen wollte, musste man auf Verkaufsfahrzeuge der umliegenden Bäckereien, Fleischereien oder anderer Einrichtungen, die regelmäßig durch den Ort fuhren, warten oder mit dem Auto in die zwanzig Kilometer entfernte Kreisstadt fahren. Wer kein Auto hatte, konnte sich nicht problemlos versorgen. Die Fahrzeiten der Linienbusse ließen das nicht zu.
Die Freiwillige Feuerwehr war nicht mehr eigenständig. Sie hatte sich mit der Feuerwehr aus dem Nachbarort zusammengeschlossen. Man musste Geld sparen. Hinter der Kirche befand sich der Friedhof. Daran grenzte der Sportplatz, auf dem der örtliche Fußballverein regelmäßig am Wochenende trainierte. Wenn hier Fußballspiele stattfanden, war das Dorf für wenige Stunden belebt, bis wieder jeder seiner Wege ging. Auch eine Schule gab es nicht mehr. Das einstige Schulgebäude war wieder Teil des Gutes. Die nicht mehr so zahlreich vorhandenen Kinder wurden mit den Schulbussen zu den umliegenden Schulen gefahren oder gleich in die Kreisstadt, wo sich auch die weiterführenden Schulen befanden.
Dem Kalender nach hätte es eigentlich noch kalt sein müssen. Aber tagsüber war es brütend heiß, obwohl kein Sonnenstrahl zu sehen war. Die Hitze drückte. Am Himmel braute sich etwas zusammen. Das war jedem im Dorf klar, wenn er nach oben schaute. Es war nur komisch, dass der Wetterbericht nichts vorhergesagt hatte. In den Bäumen am Dorfrand, wo sich das Gut befand, hatten sich sehr viele Vögel niedergelassen. Angesichts des aufkommenden Unwetters achtete keiner darauf, sonst hätte sich jeder Vogelkundige gewundert, diese Vögel hier so zahlreich anzutreffen. Es waren Kolkraben, die hier sonst nur vereinzelt vorkamen. Einer unter ihnen war unnatürlich groß, das hätte jeden Vogelkenner verwundert. Aber die Menschen im Dorf achteten nicht darauf, weil sie mit sich und dem aufkommenden Unwetter zu tun hatten.
Zunehmend bewölkte sich am Nachmittag der Himmel. Aber es kühlte sich nicht ab. Die Raben saßen die ganze Zeit in den Bäumen und waren stumm, so als erwarteten sie etwas Großes. Es sah so aus, als ob sie das Gut beobachteten. Plötzlich erhoben sich die Vögel und flogen davon. Wer sie beobachtet hätte, hätte bemerkt, dass der riesige Rabe die Schar anführte. In einer Senke, mitten auf der Ackerfläche, verschwanden alle. Aber es achtete keiner darauf. Man hatte mit dem, was da kommen sollte, zu tun und traf Vorkehrungen.
Dann wurde es stürmisch. Die Leute begannen eilig, Türen und Fenster zu verschließen. Viele Hausbesitzer ließen die Jalousien herunter. Hof-, Stall- und Scheunentüren hatte man gesichert. Man ahnte, dass das Unwetter heftig werden würde. Es wurde stockfinster. Man hatte den Eindruck, die Nacht wäre innerhalb von Minuten hereingebrochen. Die Straßenbeleuchtung hatte sich eingeschaltet und in den Häusern brannte Licht.
Der Orkan, der nun zu toben begann, ließ es in den Schornsteinen der Häuser laut aufheulen. Die ersten Äste brachen von den Bäumen. Dann wurde es taghell. Blitze zuckten auf. Merkwürdigerweise donnerte es noch nicht. Aber als es damit anfing, bekamen es die Menschen mit der Angst zu tun. Die Donnerschläge waren äußerst heftig und ließen alles ringsum erbeben. So etwas hatte hier noch keiner erlebt. Dann begann der Regen schlagartig und wie eine Sintflut. Er wurde von kirschgroßen Hagelkörnern durchmischt. Die prasselnden Hagelgeräusche trugen nicht zur Ruhe der Menschen bei. Wenige Minuten später liefen die ersten Dachrinnen über. Dazu peitschten die Windböen und die Blitze, die vom Donner begleitet wurden. Sie ließen die Einwohner erzittern. Die Wassermassen flossen als Sturzbäche von den Gehöften auf die tiefer gelegene Straße. Sie verwandelten sie in einen reißenden Strom aus Schlamm und Wasser, der Richtung Gut floss. Vor dem Gut bogen die Wassermassen ab und bahnten sich ihren Weg über die Ackerflächen. Sie flossen weiter zur Senke. Auch zum Haus am anderen Ende des Dorfes bewegten sich die Wassermassen und bogen dann Richtung Senke ab.
Das Unwetter tobte die ganze Nacht. Viele Keller liefen voll Wasser. Am Morgen war alles vorbei. Die Leute wagten sich jetzt nach draußen, um die Schäden zu begutachten. Einige Häuser hatten keine Dächer mehr und auf den Straßen lagen umgestürzte Bäume. Viele Fensterscheiben waren kaputt und sogar einige Vordächer an den Häusern. Alles Mögliche lag im Dorf herum. Die Straßen waren überschwemmt. Rohr- und Kanalsysteme waren nicht mehr in der Lage, die heruntergekommenen Wassermassen aufzunehmen. Wasser war noch ausreichend vorhanden und floss nur langsam ab. Später sollte man feststellen, dass die Straßen an einigen Stellen unterspült waren. Die Menschen waren wie betäubt. Erst allmählich kamen sie zu sich.
Die Aufräumarbeiten begannen. Hilfe ließ auf sich warten. Später sollten die Bewohner erfahren, dass es seit Menschengedenken hier so einen Sturm noch nicht gegeben hatte. Geahnt hatten sie das schon, als sie die Schäden sahen. Außerhalb des Dorfes gab es zwei Grundstücke, die nichts abbekommen hatten. Das eine war das Gut und das andere das einzeln stehende Haus am anderen Dorfende.“
Haben Sie genau aufgepasst? Es dürfte doch wohl wahrscheinlich kein Zufall gewesen, dass das schreckliche Unwetter nur zwei Grundstücke verschont hatte. Oder was glauben Sie? Wenn Sie mehr wissen wollen, dann lassen Sie sich auf diese spannende Geschichte zwischen Wirklichkeit und Fantasy ein, die nicht zuletzt viel Mut machen kann – auch und vor allem dann, wenn man sich bedroht fühlt wie Nadja Kirchner.