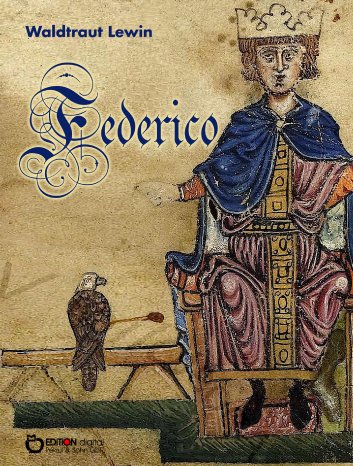Mehr Wissen und mehr Vergnügen bieten auch die anderen sechs Deals der Woche, egal ob sie nun über den unglaublichen Sommer 1976 oder von einem Schloss an der Nebel, von dem Versuch, den Mohrunger Johann Gottfried Herder zum Polen zu machen oder von einem berühmten deutschen Kaiser, der allerdings eher unter seinem italienischen Namen bekannt ist, oder von tödlichen Schüssen auf einen Finanzdezernenten handeln. Oder auch von einem astronomischen Dieb. Aber Achtung, letzteres Buch provoziert und produziert Heiterkeit – vielleicht nicht die schlechteste Art, das Leben und die Welt zu überstehen oder zumindest in die Tasche zu stecken …
Erstmals 2004 erschien bei Langen Müller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung München „Wer die Beatles nicht kennt … Flegeljahre im Arbeiter- und Bauernstaat“ von Lutz Dettmann: Da ist er, der Tunnel, an dem er sich damals immer mit seinen Freunden getroffen hat, zum Rauchen und Klönen, zum Pläne schmieden und flirten. Und – Klaus Levitzow traut seinen Augen kaum – da ist auch noch die Inschrift, die Karsten damals angebracht hat: „Wer die Beatles nicht kennt ...“. Soviel hat sich in den 20 Jahren seither verändert in dieser Stadt, doch den Tunnel und die Inschrift gibt es noch. Sie wecken in Levitzow Erinnerungen an den Sommer 1976 und er verwandelt sich wieder in den Fünfzehnjährigen, der er damals gewesen ist. Er muss wieder das Klassenzimmer verlassen, weil er im Staatsbürgerkundeunterricht Kritik geübt hat und ärgert sich darüber, dass alle anderen schweigen. Ist er denn der Einzige, der unter den Verhältnissen leidet? In jedem Fall ist er nicht der Einzige, der es liebt, im intershop einzukaufen und Jeans aus dem Westen zu tragen, denn das ist Kult – genauso wie die Schallplatten all dieser coolen Bands aus dem Westen, Jethro Tull, Sweet,10 CC und natürlich der Beatles, zu deren Musik sie auf der Schuldisco tanzen. Nach all dem Ärger in der Schule sehnt Klaus die Ferien herbei. Er trifft sich mit seinen Freunden und Freundinnen am See und genießt die Natur und das Leben und vor allem den Anblick seiner knackigen Klassenkameradinnen. Dieser Sommer 1976 ist ein heißer Sommer, der unvergessliche Erlebnisse für ihn bereithält: Den ersten richtigen Rausch, Zusammenstöße mit den Hütern des Gesetzes, die erste Enttäuschung mit einem Mädchen, die Bekanntschaft mit dem Kriegsveteran Zigahn, der ihm Dinge über den Krieg erzählt, über die sonst niemand spricht, und schließlich seine erste große Liebe. Nach diesem Sommer hat er die Kindheit endgültig hinter sich gelassen. Lutz Dettmann lässt in diesem Buch die Zeit seiner Jugend, die 70er Jahre in der DDR, wieder auferstehen. Warmherzig und mit Witz erzählt er von den Erfahrungen, die der fünfzehnjährige Klaus auf dem Weg zum Erwachsenwerden macht. Der Autor selbst erklärte im Oktober 2003 über das Geschehen in seinem Buch: Die beschriebenen Charaktere sind eine Mischung aus Fiktion und Realität. Trotzdem sind eventuelle Ähnlichkeiten mit existierenden Personen rein zufällig und nicht gewollt. Die beschriebenen Orte sind Produkte meiner Erinnerung und meiner Fantasie. Ähnlichkeiten mit existierenden Orten sind also durchaus möglich. Und er stellte seinem Buch ein schönes Zitat von Ulrich Plenzdorf aus dessen berühmten Stück „Die neuen Leiden des jungen W.“ voran: „Für Jeans konnte ich überhaupt auf alles verzichten, außer der schönsten Sache vielleicht. Und außer Musik.“ Womit wir wieder bei den Beatles wären, unter anderem bei den Beatles. Und so liest sich das Buch von Lutz Dettmann: „Und da stand ich auch schon vor dem Haus meiner Großeltern, in dem ich mit meiner Familie zwanzig Jahre gewohnt hatte. Mir kamen im ersten Moment Zweifel, denn es hatte sich völlig verändert. Dort, wo einst unsere Wohnung gewesen war, glänzten jetzt große Ladenfenster. „Apotheke“ prangte auf einem riesigen Schild, das fast die ganze Höhe der Fassade einnahm. Die alte Haustür gab es nicht mehr. Ich ging durch den Torweg und schaute auf den Hof. Alles sah anders aus: Der Schauer, die Garage, das große Stallgebäude, sie waren verschwunden. Der kleine Ahornbaum, der vor der alten Hofmauer stand, hatte einem hohen Anbau weichen müssen. Der Hof wirkte kalt und ungemütlich. Und unser Holzschuppen, der sich in ein uneinnehmbares Fort verwandelt hatte, wenn wir von Indianern aus dem Nachbarhaus angegriffen wurden - wo hatte er überhaupt gestanden? Schlagartig wurde mir bewusst: Dies war nicht mehr mein Elternhaus, und ich würde dieses Haus nie wieder betreten. Ich sah es mir noch einmal an und nahm Abschied. Doch meine Neugier war jetzt geweckt! Wie sah es sonst hier aus?
Die Bäckerei an der Ecke zur Schulstraße war zugemauert. Das Haus hatte keine Mieter mehr. Ich überquerte die Schulstraße und ging nun durch die neue Bäckerstraße, die als Sackgasse endet. Hier schien die Zeit völlig stehen geblieben zu sein. Die alten Paketbehälter - in einer der Boxen lag zum Weihnachtsfest immer ein von uns sehnlichst erwartetes Westpaket – waren entfernt worden. Aber sonst hatte sich nichts verändert.
Am Ende der Straße lehnte ich mich über die Brüstung. Die Steine der Einfassung waren mit eingekratzten Buchstaben übersät. Hier, an der Treppe, die zur Lehmstraße hinunter führt, hatten wir uns immer getroffen, Musik aus unseren leiernden Rekordern gehört, geraucht und mit den Mädchen geflirtet. Alles kam mir so vertraut vor, und immer mehr Erinnerungen, jahrelang vergessen oder verdrängt, tauchten wieder aus dem Unterbewusstsein auf. Die Wände im Tunnel, der zum Spielplatz führte, waren dick mit Graffiti beschmiert. Ich musterte die Inschriften, konnte die Zeichen nicht entziffern und wollte schon weitergehen, doch ich stutzte. Inmitten der Sprühereien war eine Stelle freigelassen worden. Dort stand frisch mit Kreide nachgeschrieben: „Wer die Beatles nicht kennt, ist ...!“ Das letzte Wort war dick durchgestrichen worden, und jemand hatte „Idiot“ darüber gesprüht. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen. Diese Inschrift kannte ich noch sehr gut. Dass sie alle diese Jahre nicht überschrieben worden war! Und da überfielen mich plötzlich die Erinnerungen und er war wieder da, der unvergleichliche Sommer 1976 ...“
Um Erinnerungen, um sehr persönliche Erinnerungen geht es auch in dem erstmals 2005 im Mauer Verlag Wilfried Kriese, Rottenburg a/N. erschienenen Buch von Uwe Berger „Pfade hinaus. Episoden der Erinnerung“: Darin gibt der Autor konzentrierte persönliche Erinnerungen wieder. Es sind authentische Erlebnisse, die das Gestern mit dem Heute und das Nahe mit dem Fernen verbinden. Die Gedanken wandern zwischen Literatur und Natur, setzen gegen erdrückende Diktatur lebendige Toleranz. Episodenhaft angedeutet sind Schicksale und Entwicklungen, und der Weg eines Hugenotten zum Weltbürger zeichnet sich ab.
Greifen wir eine Episode aus diesen Erinnerungen heraus:
„Verletzungen
Als Vierzehnjähriger betrat ich zum ersten Mal polnischen Boden, den ebenen, lehmigen Boden zwischen Warthe und Weichsel, und ich spürte beklommen „die Stille, diese harte Stille, die von all dem Schreien nicht ausgefüllt werden konnte“. In Konin gestikulierte und kreischte ein hellbraun gekleideter Hanswurst vor evakuierten Kindern aus Berlin. Was er sagte, weiß ich nicht mehr; der Klang seiner Worte aber war gefährlich. In dem Dorf Kleczew nördlich von Konin lernte ich faschistisches Lagerleben kennen. Es war das Kriegsjahr 1943. Noch heute, wenn ich an den Ort denke, rieche ich Heu und Dung, schmecke ich Schuld und Angst.
Dreieinhalb Jahrzehnte später, am 26. September 1980, saß ich östlich von Warschau im Kellergewölbe des von Wald und Finsternis umgebenen Landschlosses von Czarnolas. Dort trafen sich Literaten aus Polen und anderen europäischen Ländern. Mit Marian Pankowski, einem würdigen, weißhaarigen Mann von gewinnendem Wesen, kam ich ins Gespräch. Er hatte eine Professur für Slawistik an der Universität von Brüssel inne. Gebürtiger Pole, war er durch die Hölle von Auschwitz gegangen. Er sagte in fließendem Deutsch: „Die schlimmsten Kapos, die ich in Auschwitz kennenlernen musste, waren Polen.“ Das System pervertiere die Menschen.
Zuvor hatten wir in der Kapelle des Schlosses eine mystisch inszenierte Lesung von Jan Kochanowskis „Treny“ erlebt, dem Liederzyklus auf den Tod seiner Tochter. Die rezitierenden Warschauer Studenten stellten eindringlich die polnische Schicksalsklage dar, gegen die sich der behauptende Wille des großen Renaissance-Poeten erhebt: Was ist wohl leichter: Sich im Schmerz zu winden oder hart mit der Natur zu ringen? Wo Kochanowski gelebt hatte, fühlte ich mich polnischer Geschichte, polnischem Wesen nahe.
In Polen bin ich auch dem klassischen deutschen Geist und seinen Quellen begegnet. Als Mitglied einer Regierungsdelegation fuhr ich am 19. Oktober 1986 mit dem Polonisten Dr. Dietrich Scholze und der polnischen Journalistin Katarzyna Kielczewska von Warschau aus nach Morag in Masuren. Morag, zu deutsch Mohrungen, ist der Geburtsort von Johann Gottfried Herder. Weimarer und Warschauer Wissenschaftler hatten ein kleines Museum zum Gedenken an Herder neu gestaltet. Es sollte feierlich wiedereröffnet werden. In dem von einem polnischen Fahrer gesteuerten Polonez unterhielten wir uns angeregt in deutscher Sprache, die Katarzyna tadellos beherrschte. Als Scholze wieder eine seiner deutsch-nationalen Tiraden losließ und hinzufügte: „Na ja, da werdet ihr ja wieder gemeinsam den Kopf schütteln“, sah ich die neben mir sitzende Katarzyna verwundert an und erwiderte: „Sind wir denn so? Nein. Nicht wahr, wir sind tolerant.“ Scholze lächelte etwas gequält.
Ich mochte Katarzynas lang gestrecktes Gesicht, ihre sanfte Klugheit. Bei einem Halt legte sie ihre Stirn gegen die weiße Rinde einer Birke. „Das macht man bei uns so. Das hilft gegen Kopfschmerzen.“ Wir fuhren durch dichte Wälder und vorbei an dunklen Seen. Dann tauchte das Städtchen Morag auf. Kirche und Rathaus, alte Backsteinbauten umgeben die Stelle, wo einst das Geburtshaus Herders stand. Das nahe gelegene Palais des Grafen von Dohna beherbergte das Herdermuseum sowie Ausstellungen alter niederländischer Porträts und der Landschaften eines modernen Niederländers.
Als wir kamen, drängten sich schon viele Menschen. Zuerst sprach zu der stehenden Versammlung der örtliche Woiwode, dann ein polnischer, dann ein deutscher Wissenschaftler, dann der Gdansker DDR-KonsuI und schließlich ich. Eigentlich war es eine Komödie. Aber ich wollte bestimme Sätze loswerden. Katarzyna kannte sie bereits und übersetzte: „Im Gegensatz zu Schiller, der das Reich der Freiheit in die Kunst verlegt, fordert Herder die Einheit von Erkenntnis und Wirken. Schon 1772 hat Herder auf die Leistung der alten Griechen verwiesen, fremde Ideen in ihre eigene Natur zu verwandeln, und die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen den Kulturen erkannt. In den ,Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit' rühmt Herder die geräuschlose, fleißige Gegenwart der slawischen Völker; und er wünscht ihnen, dass sie von ihren Sklavenketten befreit würden und ihre schönen Gegenden vom adriatischen Meer bis zum karpatischen Gebirge als Eigentum nutzen und ihre alten Feste des ruhigen Fleißes und Handels auf ihnen feiern dürften. In den ,Briefen zur Beförderung der Humanität' aber, jenem bedeutenden Werk, das unter dem Eindruck der Französischen Revolution entstand, verbindet sich der Gedanke der freien nationalen Entwicklung Deutschlands mit dem Gedanken der Freundschaft zu allen Völkern. Jede Nation müsse es als unangenehm empfinden, wenn eine andere Nation beschimpft und beleidigt wird ... Wir Deutschen haben besonderen Grund, uns daran zu erinnern.“
Wie mir Katarzyna auf meine Frage hin anvertraute, hatte der polnische Wissenschaftler durch pedantische Genealogie nachweisen wollen, dass Herder ja eigentlich eher Pole als Deutscher sei. Bei dem anschließenden Essen für ein paar Ehrengäste stand Scholze auf und brachte einen Toast aus. „Oh, er spricht ja polnisch“, bemerkte jemand bewundernd. „Und was hat er gesagt?“, fragte ich Katarzyna. „Dass sich der andere Teil der Delegation zurzeit in einer Chopin-Gedenkstätte aufhalte und dass Chopin ja eigentlich Deutscher sei."
Erstmals 1991 brachte Brigitte Birnbaum bei der damaligen Landesverlags- und Druckgesellschaft mbH Mecklenburg & Co. KG. „Das Schloss an der Nebel“ heraus: Baugeschichten, Schlossgeschichten sind immer Menschengeschichten, denn jede Zeit hat ihre Schicksale und im Güstrower Schloss wohnten nicht nur die hochgeborenen Fürsten zu Wenden, die Grafen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herren. Oder General Wallenstein. Auch Kinder, nicht nur adlige, lebten dort, wie das Wendenmädchen Ilsabe, „kleine Küchenschabe“ genannt, und der Fuerböter Jochim oder Bastian und Maria, die Kinder der eingefangenen Landstreicher. In kleinen, spannenden Erzählungen wird die mit dem Leben dieser Kinder verbundene Schlossgeschichte nahegebracht.
Und so fangen diese Bau-, Schloss- und Menschengeschichten an: Wir lernen Ilsabe kennen. Wer Ilsabe ist? Einen Moment bitte: „Vorm Schloss wollten wir uns treffen. So war es vereinbart. Hier vor dem Fürstlichen Haus zu Güstrow. Ich finde, es sieht noch gar nicht so alt aus, wie es sein soll, auch nicht besonders prächtig. Eher einzigartig und riesig, obwohl von der Brücke aus niemand merkt, dass beinah schon die Hälfte fehlt. Noch immer wirkt es viel zu groß für die kleine Stadt. Ein Palazzo in Mecklenburg. Mir scheint es fremd in dieser Landschaft. Aber das macht wohl mein Ärger, weil ich warten muss.
Wie ein Wachsoldat pendle ich vor dem Torhaus hin und her. Ist das eine Art, mich lauern zu lassen? Da hätte ich mich auch mit Wallenstein oder dem Herzog Ulrich verabreden können. Die Herren wären ebenso wenig erschienen. Und wenn? Ja, wenn! Was hätte ich dann gesagt? Wie müsste ich ihn ansprechen, den Herzog Ulrich zu Mecklenburg? Mindestens wohl mit „Von Gottes Gnaden Durchlauchtigster hochgeborener Fürst zu Wenden, Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr". Hätte er sich überhaupt ansprechen lassen? Von mir? Mitten auf der hölzernen Fallbrücke, die mit Ketten auf- und zugemacht wurde? Seine Leibgarde würde es mir schon gezeigt haben. Mit llsabe wär ich ins Gespräch gekommen, mit ihr bestimmt. Wenn ihr zum Schwatzen auch selten Zeit bleibt.
Eben hat sie die Borsten aus dem gebrühten Ferkel puhlen müssen, und es liegen noch ein halbes Dutzend geschlachteter Hühner zum Rupfen. „Späl nich rümmer!", wird sie vermahnt. Die Frau des Obersten Herzoglichen Kochs und Küchenschreibers keift gern, hält aber sofort die Hand über llsabe, wenn einer glaubt, der Kleinen etwas am Zeug flicken zu müssen. Und als sie bemerkt, wie eine der älteren Mägde schadenfroh feixt, der unangenehmen Rupferei zu entkommen, packt die Frau die Elfjährige am Arm und schiebt sie zur Tür. „Geh und sieh nach, ob der Herr Bildschneider und seine Gesellen aufgegessen haben.“ Das lässt sich Ilsabe nicht zweimal sagen. Die Finger an der groben Schürze abwischend, hüpft sie hinaus in den leichten Mairegen und über den Schlosshof ins Nige Hus. Die eichene Wendeltreppe im Turm steigt sie langsamer nach oben. Fröstelnd bewegt sie die Schultern. In der Küche war es heiß. Auf der Treppe zieht es aus allen Luken.
Fertig ist das Nige Hus noch immer nicht, obwohl daran gemauert und gezimmert und Ziegelsteine aus einem abgebrochenen Kloster herangefahren werden, seit llsabe denken kann. Im August jenes Sommers, in dem sie hier geboren wurde, also Anno 1557, wie man ihr erzählte, hatte dieser Teil der alten Burg eines Tages aus heiterem Himmel in Flammen gestanden. Kein Blitz entfachte das Feuer, keine unbeaufsichtigte Fackel, kein Funken aus dem Kamin. Herzog Ulrich fragte seltsamer Weise gar nicht danach. Er war verreist, als das Unglück geschah und brachte bei seiner Rückkehr gleich den Baumeister für das neue Haus mit, einen gebürtigen Italiener namens Franciscus de Pario de Bizone oder deutscher: Franz Parr.
Des Herzogs königliche dänische Schwiegereltern gaben Geld, damit ihre Tochter Elisabeth nicht in einer Ruine hausen musste. Parr sollte bauen, wie es in Italien schon lange Mode war und wie es Ulrich in Süddeutschland, wo er aufwuchs und studierte, gesehen hatte: mit großen Fenstern in einer Reihe, Verbindungsgängen im Inneren des Hauses; mit Schornsteinen und Kachelöfen; Glasscheiben in den Fenstern und Loggien, von Säulen getragen. Franz Parr versuchte, die Wünsche des Herzogs zu erfüllen. Er baute in die Breite und fünf Etagen hoch, überzog die plastisch geformten, roten Backsteine mit hellem Mörtel und fasste sie farbig.
Aber was schert solches llsabe, zumal Franz Parr nicht mehr im Lande weilt. Längst ist das dänische Geld vermauert, so wurde in der Küche geflüstert, und Parr hatte sich einem anderen Herrn verdingen müssen. Geblieben war sein Bruder Christoph, der Bildschneider, und zu ihm ist das Mädchen geschickt.
llsabe tritt aus dem Turm auf die Galerie, stemmt sich gleich gegen die erste Tür. Sie ist verschlossen. Das Mädchen läuft unter den beiden Fenstern vorbei zur zweiten Doppeltür, an der ihr die Wache den Eintritt versperrt. Der Soldat tut's nur zum Scherz, denn er kennt natürlich die kleine Küchenschabe, und will er's nicht mit der Frau vom Oberhofkoch verderben, lässt er sie besser in Frieden und hinein.“
Sein Debüt als Feuilletonist legte Jürgen Borchert 1977 im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig vor – „Klappersteine“, so der neugierig machende Titel: „Zu den vergnüglichsten Texten in diesem Debütband mit Feuilletons des damals 36-jährigen Schriftstellers Jürgen Borchert gehört der mit dem wahrlich feuilletonistischen Titel „Vorschlag, ein Feuilleton über das Luftschiff zu schreiben“. Gewidmet hatte Borchert dieses Feuilleton seinem Lehrer, Mentor und späteren Freund Heinz Knobloch, der viel dafür getan hat, dass sich dieses journalistisch-literarische Genre in der DDR ausbreiten durfte und viel dafür, dass sich auch Leute fanden, die Feuilletons schreiben konnten – wie eben Jürgen Borchert.
Schon in seinem Debütband zeigt der noch junge Feuilletonist, dass er sein Handwerk versteht, blickt auf seinen eigenen Balkon, auf allerhand Leute und Landschaften, auf das eintönige Leben und auf die Relativitätstheorie sowie in Familienpapiere. Manches von dem, was er später und manchmal noch ausführlicher veröffentlicht, wird hier vorbereitet.
Außerdem beantwortet Jürgen Borchert in dem gleichnamigen und titelgebenden Feuilleton die Frage, was denn überhaupt Klappersteine sind: „Rund sind sie, meist hühnereigroß, schwarz, mit weißen und grauen Einsprengseln und Löchern, und hier und da führen winzige, weiß umrandete Gänge in das geheimnisvolle Innere der Feuersteinknolle. Wenn man sie leicht schüttelt, klappert es in ihrem schwarzen Bauch. Da staunt man, wiegt die Steinknolle prüfend in der Hand, schüttelt erst den Kopf und dann noch einmal den Stein - kein Zweifel, es klappert, wider alle Logik. Ein Klapperstein.“ Und was haben sie mit Feuilletons gemeinsam? Auch die muss man ein wenig schütteln, um alles zu hören …
Jürgen Borchert war ein gebürtiger Perleberger. Und daher soll hier als Reverenz und Einladung zum Jürgen Borchert das Feuilleton „Kindersegen“ über einen fruchtbaren Perleberg stehen. Und man achte neben vielen anderen Dingen vor allem auf den Schluss dieses typisch Borchertschen Textes: Hier wird erzählt von Mathias Hasse, Bürgermeister der Stadt Perleberg von 1659 bis 1689, Sohn des Bürgermeisters Joachim Hasse und seiner Ehegemahlin Elisabeth, geborener Krusemarckin. Es wird erzählt von seiner erstaunlichen Manneskraft, die ihn befähigte, im Laufe von vierzig Jahren, nämlich von 1645 bis 1685, einundzwanzig Kinder zu zeugen, deren sieben älteste ihm zu seinen Lebzeiten vierundzwanzig teils tot, teils lebend geborene Enkel schenkten. Dass er dazu nur zwei Frauen hatte, nacheinander, versteht sich, und nicht dreihundert wie angeblich der starke August von Sachsen, spricht für ihn.
Auch war er seinen Kindern ein guter Vater, was in jenen schweren Zeiten nach dem Dreißigjährigen Kriege sicher mancherlei Opfer verlangte. Seine Töchter verheiratete er vorteilhaft, seine Söhne protegierte er in ebenso vorteilhafte Stellungen, und als seine erste Frau, Margaretha Vogels, Anno 1662 das Zeitliche segnete, erst vierunddreißig Jahre alt, bei der Geburt ihres zehnten Kindes, bewarb sich ihr ältester Sohn Joachim bereits um die Stelle des Ratsverwalters zu Havelberg. Bald darauf heiratete die Schwester Elisabeth den reichen Bäcker Theodori, wurde Georgius Verwalter beim Freiherrn von Nettelbeck, Mathias jr. hingegen Pastor zu Lenzen und Andreas Apotheker zu Seehausen, Anna des Lenzener Bürgermeisters Ehweib; Margareten gab er einem Ruppiner Handelsherrn und verlobte Marien dem Wusterhausener Bürgermeister. Auf diese Weise überzog er Prignitz und Altmark mit seinem Geschlecht, war er doch nicht umsonst der „Priegnizischen und Alte Märckischen Stätte Schuldenwercksverordneter“.
Über den Tod seiner ersten Frau tröstete ihn die zweite bald hinweg, die er 1663, nach strikter Einhaltung des gebührlichen Trauerjahres, ehelichte: Anna, geborene Ratjen, nur zwei Jahre älter als sein ältester Sohn. Auch Anna war fruchtbar, ja schlug noch den Rekord ihrer bedauernswerten Vorgängerin. Sie schenkte dem Bürgermeister elf Kinder, von denen Daniel, das Jüngste, 1685 das Licht der Welt erblickte, nur vier Jahre vor dem Tode des Vaters, der 1689 starb, „66 Jar, 7 Wochen und 3 Tage alt“, damals ein biblisches Alter.
Kurz vor seinem Tode jedoch ließ er, ein Denkmal zu setzen, sich und seine Familie malen: Er selbst in der unteren Mitte des ovalen Riesenbildes, links die erste, rechts die zweite Frau, und dann nach links und rechts aufsteigend die jeweiligen Kinder, der Vollständigkeit halber auch die Totgeburten, kleine, zierlich in Steckkissen gebundene Leichen mit stereotypen Puppengesichtern in winzigen Särgen anstelle des Porträts. Oben, wiederum in der Mitte, treffen sich die Kinderreihen, die auf die Äste eines genealogischen Baumes gereihten Medaillons, und umrahmen so, von Joachimus bis zu Daniel, dem vierzig Jahre jüngeren Bruder, eine im Zentrum des Ovals befindliche Kreuztragungsszene; denn das Bild war für die Kirche bestimmt. Warum Mathias Hasse, der generöse Stifter, ausgerechnet eine Kreuztragung bestellte, mag symbolische Gründe gehabt haben, immerhin, bei einundzwanzig Kindern. Erheben sich nun im Hintergrunde der Szene die Türme und Zinnen Jerusalems, der hochgebauten Stadt? Mitnichten; Perlebergs Türme sind es, die da in die biblische Landschaft ragen, und recht klein ist dies Mitteloval, wenn man den Platz für die Familie dagegen hält: Allzu viel Gottesfurcht kann da nicht im Spiele gewesen sein.
Das Bild, drei zu zwei Meter groß, in riesigem Eichenrahmen, zentnerschwer, hängt im Museum. Neulich stand eine junge Frau davor, die, Ursache, Wirkung und gewisse Errungenschaften der Neuzeit bedenkend, die staunenswerte Nachkommenschaft des barocken Bürgermeisters interessiert betrachtete, während ihr Mann eilig (Nun komm schon von dem ollen Bild weg!) der unverfänglicheren Frühgeschichte zustrebte.
Unten, ganz klein, steht Jesaja 8; 18: Siehe hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat.
Nur ein paar Jahre zuvor hatte Gerhard Branstner im Verlag Das Neue Leben Berlin ein im besten Sinne des Wortes merkwürdiges Buch veröffentlicht: „Der astronomische Dieb. Utopische Anekdoten um den erfindungsreichen Mechanikus Fränki und seinen ihm anhängenden Freund Joschka“: Hier werden utopische Spiele geboten. Hauptakteur Fränki, dessen Auftritte kauzig, töricht oder gönnerhaft sein können, kennt kein Faulbett. Mit seinem Freund Joschka knüpft er Einfälle und Begebenheiten zu Anekdoten. Schelmischer Eigensinn rückt dabei manches Abenteuer in die Nähe eines skurrilen Spaßes. Einmal jagen sie durchs Weltall und narren mit listigen Manövern unangemessene Ansprüche ferner Sternenbewohner, dann wieder sind sie in heimischer Umgebung und probieren die halbe Unsterblichkeit aus. Das Inventar ihrer Spiele sorgt für Abwechslungen: Energieprobleme scheint ein Sonnenmobil vergessen zu machen, eine Ehrenkompanie lässt sich auf ganz andere Art abschreiten, Ärgernisse des Alltags werden durch schrille Signaltöne unüberhörbar gemacht. Der Roboter stellt sich in gelungener Vervollkommnung vor. Schreibern von Kriminalromanen wird ein guter Rat für alle Zeiten und Gelegenheiten gegeben.
Das alles geschieht mit astronomischer Sicherheit. Also pünktlich und fast immer reibungslos. Und haben Fränki und Joschka mal ein etwas problematisches Abenteuer zu bestehen, gelingt ihnen ein witziger und das heißt hier rettender Einfall. Die utopische Anekdote stellt sich als Spiel mit fantastischen Apparaturen und gedanklichen Verstiegenheiten vor. Bei aller Kuriosität, die auch von singenden Blumen und einem Dirigenten, dem selbst bei größter Hitze kein Stirnschweiß perlt, zu berichten weiß, gehen in Branstners Anekdoten Gemütlichkeit und stimmungsvolle Heiterkeit nicht verloren.
Wollen Sie noch mehr erfahren? Hier der Prolog zum „Astronomischen Dieb“: Als Fränki, damals noch keine fünf Jahre alt, einen Hampelmann geschenkt bekam, hing er ihn mit der Hinterseite nach vorn auf, denn er wollte sehen, auf welche Weise Arme und Beine bewegt wurden, wenn man an der Schnur zog. Wenig später hing eine Unzahl selbst gefertigter Hampelmänner in Fränkis Kinderzimmer. Mechanische Gliederpuppen, mit Triebfedern versehen, gesellten sich hinzu. Und bald hatte sich Fränki eine eigene Welt geschaffen, klein zwar, aber mit vielen lustigen Gestalten bevölkert, geheimnisvoll in ihrer äußeren Erscheinung, doch durchschaubar in ihrem inneren Mechanismus, eine Welt des Spiels nur und doch von tieferer Wirklichkeit, denn im Spiel erkannte Fränki, dass nur das Spiel mit der Welt sie uns heimisch macht.
So nimmt es nicht wunder, dass Fränki, das Studium der mechanischen Künste hinter sich und in die Welt der Wirklichkeit versetzt, auch sie durch das Spiel mit ihr sich zu eigen machen wollte. Doch stellte er bald fest, dass diese Welt darauf nicht eingerichtet war. Also machte Fränki sich daran, sie zum Zwecke der spielerischen Handhabung einzurichten, denn nur in dieser Form, so pflegte er zu sagen, erfüllt sie ihren menschlichen Sinn. Darin nun war Fränki seiner Zeit ein wenig voraus und unversehens in die Zukunft geraten, und er sah sich allein und ohne Mitspieler. Ein solcher aber war ihm wichtiger als das Spiel selbst. Ohne Gesellschaft, davon war Fränki überzeugt, ist der Mensch das bedauernswerteste Geschöpf unter der Sonne.
So ist es nur verständlich, dass er, als er eines Tages Joschka kennenlernte und in ihm einen gleich gesinnten Menschen fand, sich diesen zum Freunde machte und rief: „Wenn wir beide ausziehen, um unser Spiel mit der Welt zu treiben, haben wir die Welt schon so gut wie in der Tasche! Und den Spaß haben wir dazu!“
Ein gutes Jahrzehnt nach dem „Astronomischen Dieb“ von Gerhard Branster erschien im selben Verlag Neues Leben Berlin der Roman „Federico“ von Waldtraut Lewin, der einem eine große historische Persönlichkeit auf äußerst kunstvolle Weise näher bringt: Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen, in seinem wahren Heimatland Italien Federico genannt, ist eine fast legendäre Persönlichkeit des Mittelalters, eine schillernde Gestalt zwischen Genialität und Machtwillen, Grausamkeit und Liebesfähigkeit. Ein Leben voller Erfolge und Höhepunkte, aber auch voller bitterer Niederlagen. Der Mann, der seiner Zeit weit voraus war, wird hier durch die Augen einer Frau gesehen: Der Zeitzeugin Truda, die sich ein Bild von diesem Herrscher machen will, dem sie gedient hat ...
Auch die Sprache dieses Buches ist etwas ganz Besonderes, wie der folgende Auszug beweisen mag:
„Ankunft
Wieder schwamm eine Lichtinsel auf mich zu. Etwas legte sich kissengleich unter meine Füße, ich begann zu gleiten, als segelte ich über eine Eisfläche. Watte schien in meine Ohren zu dringen, kein Ton kam jetzt mehr an.
„Zu sagen weiß ich nicht, wie’s zugegangen. Dass ich so weit den rechten Weg verlor/So tief war damals ich in Schlaf befangen.“ In einer Hand das Salzkorn, in der anderen das Brot, fuhr ich dahin, es stand nicht mehr bei mir; wer bis hierher gekommen war, wurde abgeholt.
Ich wusste nicht, was mich erwartete, nur eins schien sicher zu sein: Dass für mich das Ziel ganz anders aussehen würde als jene Reiche, in denen Orpheus, in denen Dante geweilt hatten. Jeder schuf seine Welten aufs Neue, jedem öffneten die Träume andere Weiten nach seinem Bild. Mein Schlaf war wohl tief genug, um hinzugelangen.
Die Münze unter meiner Zunge schmeckte kalt und bitter. Obgleich ich bewegt wurde, lief ich weiter. Ich wollte nicht auf einem Leitstrahl hingelangen. Ich wollte selbst unterwegs sein, solange es nur ging. Wie lange es ging, war nicht abzusehen.
Die Erde trieb Blasen. Kuppeln wölbten sich auf, allmählich nahmen die Auswüchse Gestalt an. Auf einem kahlen Hügel erhob sich die wohlbekannte Krone, das Achteck von Castello del Monte, im Helldunkel erkannte ich die von der Sonne verbrannte Erde, die abbröckelnden Mauern, das zu Schutt zermahlene Tor, die fast ausgelöschten Zierate. Es waren die Trümmer von heute, nicht das herrliche Schloss von einst.
Mit all meiner verbliebenen Kraft stemmte ich die Hacken in das Wolken- oder Luftkissen unter meinen Füßen, versuchte, mich zurückzuhalten. Das wollte ich nicht, nein! Das kannte ich. Die Trümmerwelt von Federicos Taten war mir nur allzu vertraut. Die waldreiche Landschaft war Wüste geworden, die Bauwerke Steinbrüche für die Nachwelt, sein Italien erst kein Land und dann eins des Chaos, sein Frieden den Räubern zur Beute, seiner Göttin Gerechtigkeit hatte man Nase und Hände abgehauen, und sie, die nicht blind gewesen war, sah nun augenlos in die verdorrte Terra di Lavoro von damals.
Wo alles geblieben war, wollte ich wissen, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. „Er lebt und lebt nicht“, hatten sie nach seinem Tode geschrieben, als seine Unruhe noch durch die Völker geisterte und sie auf der Nordseite der Alpen auf ihn und seine Herrschaft warteten, so sehnsüchtig, wie je ein Volk auf seinen Erlöser gewartet hat. Sie warteten — je mehr man sie drückte, um so sehnsüchtiger. Er war wacher als alle, als ich noch mit ihm zusammen war. Er konnte vierundzwanzig Stunden zu Pferde sitzen und einen Gerichtstag abhalten danach, ohne gegessen und getrunken zu haben, oder eine Schlacht schlagen. Oder jemanden ein Gedicht vortragen lassen oder auch ihm mit einem Tritt seiner sporenbewehrten Stiefel den Leib aufreißen ... Zu wem will ich da eigentlich? Ich will es wissen. Ich habe nur einmal gedient. Wem habe ich gedient? Ich presse die Finger zu Fäusten. Ja, es ist wieder fort.
Die Erdhügel nahmen jetzt bekannte Formen an. Hallen, Gassen, die zerbrochenen Glasscheiben alter Gewächshäuser. Fahrzeugwracks. Fuhr ich etwa zurück in die ungestalte Wildnis hinter meinem Stall?
Ein schneidender Wind kam auf und ließ das alles unter meinen Füßen zerflattern. Es war auf eine helle Art dunkel. Meine Ohren schmerzten vom Nicht-Hören. Ich war da.
Zurück in die Gegenwart, in die Zeit kurz nach der Wende. 1994 veröffentlichte Erik Neutsch im Dingsda-Verlag Cornelia Jahns. Querfurt seinen Roman „Totschlag“, der auf Wunsch des Autors nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt wurde: Ist es Mord, ist es Totschlag? Der allseits geachtete Facharbeiter Manfred Gütlein erschießt den Finanzdezernenten der Stadt, in der er wohnt, da er um seine Existenz fürchtet, auch um das Haus, das er sich zeitlebens erträumt und, unter Mühen, erbaut hat. Gewiss ist er der Täter, aber ist er nicht zugleich auch ein Opfer des Zusammenpralls zweier sich bisher feindlich gegenübergestandenen Gesellschaftsentwürfe?
Erik Neutsch, der in der DDR zu den meistgelesenen Schriftstellern gehörte, weil er in seinen Büchern die Intentionen vieler Menschen traf, geht in diesem Roman den Ursachen nach, die zu dieser Tat Gütleins führten. Mit weitgehend dokumentarischem Stil, ohne auf das Innenleben seiner Figuren zu verzichten.
„Totschlag“ ist eine erste Abrechnung mit dem, was - offenbar im Gegensatz zu ihm - andere als eine „geglückte“ Vereinigung beider deutscher Staaten betrachten. Kritisch war er schon immer. Er bleibt dabei. Es gibt in diesem Roman keinen Bruch zwischen dem Autor Neutsch und seinen früheren Werken. Nach einer Zeit des Bedenkens und - wie er sagt - des „bewussten Schweigens“ legte er in seinem erstmals 1994 erschienenen Roman wiederum ein Zeugnis seines erzählerischen Könnens vor.
Und genau wie der Autor des ersten Deals dieser Woche, Lutz Dettmann, hat Erik Neutsch seinem Roman einen wichtigen Hinweis vorangestellt: Dieses Buch möchte als Mär verstanden werden, allerdings als eine deutsche: Nichts ist wahr oder alles. Personen und Handlung sind selbstredend frei erfunden. Sollten sich trotzdem Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit ergeben, so wäre es rein zufällig und bleibt Vermutung.“ – so Erik Neutsch.
Und nun ein Blick in das 1. Kapitel dieses ungewöhnlichen und eminent politischen Romans – ein echter Neutsch eben: „Eines Tages, das war vorauszusehen - sofern man aufmerksam, nüchtern zwar, doch nicht ohne Anteilnahme, vor allem den Wandel der sozialen Verhältnisse in den neuen Bundesländern seit der Vereinigung beobachtete - hatte es zu einer solchen Bluttat kommen müssen, und zu hoffen blieb nur, daß sie nicht noch Schule machte! Sie war das Werk eines einzelnen, ja, eines Einzelgängers, lag also, obwohl durchaus vergleichbar, anders als ein Jahr zuvor der Fall Rohwedder, des damaligen Treuhandchefs, dessen Ermordung, wie bis heute vermutet, von einer extremistischen Terrorgruppe geplant und ausgeführt wurde, lag anders auch deshalb, weil sie nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erfolgte, sondern geradezu im klassischen Gewande, demonstrativ in aller Öffentlichkeit, sich abspielte. So gibt es auch wenig zu recherchieren, zu enträtseln schon gar nicht, lediglich nachzuvollziehen, denn die Fakten liegen ebenfalls offen, vor aller Augen ausgebreitet und sind von Geheimnissen kaum umwittert. Dafür sorgte bereits die SATZ, die aus einem früheren SED-Organ hervorgegangene, mittlerweile von einem westdeutschen Medienkonzern aufgekaufte und gesteuerte Tageszeitung der Region, indem sie unentwegt berichtete. Zu Widersprüchen, eher Ungereimtheiten neigte sie nur in ihren Kommentaren, was jedoch dem ziemlich willkürlichen Ermessen der Redakteure überlassen blieb, etwa dann, wenn sie über die Motive des Täters nachzudenken versuchten. Übereinstimmung hingegen, und zwar total wie sonst selten auf ihren rund dreißig Seiten täglich, herrschte stets, sobald der Hergang und wohl auch die Genesis der Tat beschrieben wurden.
Weitere Quellen, woraus zu schöpfen sich anbietet, sind natürlich die Akten in Vorbereitung des Prozesses, soweit man an sie herankam und Einblick nehmen konnte, wobei kaum von Belang sein dürfte, daß Anklagevertretung und Verteidigung sich zumindest in einem Punkte frontal gegenüberstanden, sich nämlich jene auf Mord und diese auf Totschlag zu plädieren einrichtete, denn dergleichen Kontroversen sind ja allgemein üblich. Nicht üblich allerdings - und das zeigte sich hier ebenso wie in den Kommentaren der SATZ - war, wie das Motiv der Tat zu beurteilen sei. Das war neu. Bisher unbekannt, da in der deutschen, man muß genauer sagen: bürgerlichen Gerichtsbarkeit noch nie zuvor verhandelt, weshalb um Verständnis gebeten wird, wenn hier und dort - um der Gerechtigkeit zu dienen – auch Fiktives in den Zeugenstand gerufen wird.
Denkbar ist zweifellos, daß sich ein ähnlicher Fall, ob nun aus anderem Anlaß und mit anderem sozialen Hintergrund oder nicht, im Osten Deutschlands hätte zutragen können (oder noch zutrüge). Wäre das Motiv dasselbe, würde er sich zu dem hier geschilderten vollkommen kongruent verhalten, bis hin zur blutigen Katastrophe. Denn was zusammenprallte, war eine unterschiedliche Vergangenheit von über vierzig Jahren, eingeschlossen ein unterschiedliches Rechtsempfinden, sowohl beim Täter als auch beim Opfer, nach einem Leben beider auf dem Boden unterschiedlicher Gesetze.“
Falls Sie sich übrigens für die Erinnerungen von Uwe Berger entscheiden, in denen auch von dem Besuch in Morag/Mohrungen und dem dortigen Herder-Museum die Rede ist, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal mit Johann Gottfried Herder zu beschäftigen – und vielleicht einmal das Museum in seiner Geburtsstadt besuchen. Auf einer informativen Internet-Seite heißt es beispielsweise dazu: Herder, dessen „Stimmen der Völker in Liedern“ nicht unbeträchtlich zum Erwachen eines nationalen Bewusstseins vor allem bei Polen und Litauern beitrug, wird im Mohrunger Museum gebührend gewürdigt. Das Museum befindet sich im Pałac Dohnów/Dohna-Palais, dem barocken Stadtschloss der Dohnas, das auf einem Teil der mittelalterlichen Stadtmauer steht.
Das „Dohna-Schlösschen“ genannte Stadtpalais der in Schlobitten residierenden Familie Dohna wurde auf einem Grundstück erbaut, das Achatius von Dohna 1561 erworben hatte. Es beinhaltete Teile der Stadtmauer und der Basteien, auf denen der Grundbau errichtet wurde. Sein Nachfahr Fabian zu Dohna zum „Dohna-Schlösschen“ erweiterte. Dem großen Stadtbrand von 1697 fiel auch das Dohna-Palais zum Opfer. Erst 1717 begann der Wiederaufbau – nun als barocke Residenz – unter dem Baumeister Johann Caspar Hindestein.
In den letzten beiden Jahrhunderten diente der Bau als Landratsamt mit Wohnung für den Landrat. Im Jahr 1928 verkauft Alexander zu Dohna-Schlobitten das Dohna-Schlösschen dem damaligen Landkreis Mohrungen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Bau stark beschädigt. Der Wiederaufbau in der Gestalt des 18. Jahrhunderts dauerte mit einigen Pausen von 1976 bis 1985. Zentralelement des heutigen Dohna-Schlösschens ist der Turm von dem etwas abgeknickt der rechte und linke Flügel abgehen. Nach der Fertigstellung zog 1986 die Außenstelle Morąg des Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn/Allenstein) ein und richtete dort das Herder-Museum ein.
Neben der Ausstellung zu Herders Leben und Werk gibt es dort noch eine Sammlung niederländischer Malerei, eine Portrait- und Epitaphsammlung im Ballsaal zu sehen. Dazu kommen historische Räume wie den Biedermeiersalon und den Barocksaal mit vielen Einrichtungsgegenständen aus dem Dohna-Besitz. Das Muzeum Warmii i Mazur befindet sich im unübersehbaren Pałac Dohnów an der Straße ul. Dąbrowskiego 54.“ Auch so gesehen dürfte Morag/Mohrungen eine Reise wert sein …