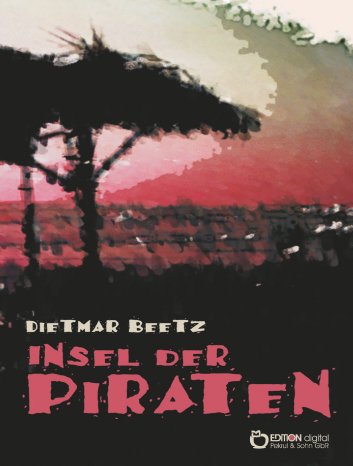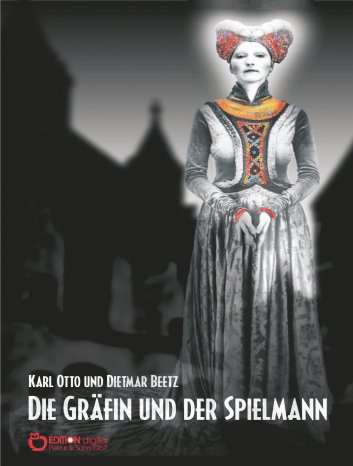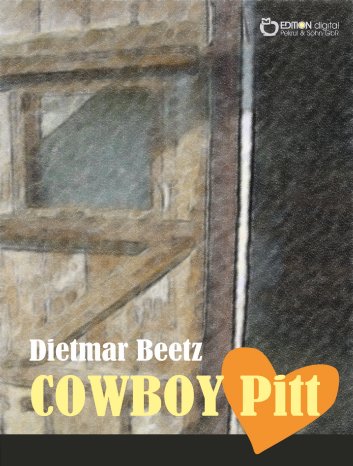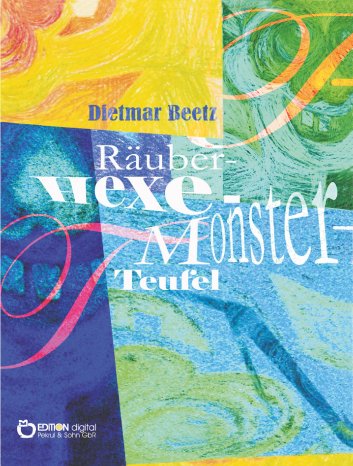Zu seinen vielen Veröffentlichungen gehören sowohl Kinder- und Jugendbücher, Kriminal- und Abenteuerromane als auch Hörspiele, Aphorismen- und Gedichtbände. Nach 1989 entdeckte Beetz die japanische Versform Haiku für sich. Auch die fünf Deals der Woche dieses Newsletters erlauben einen Eindruck von der literarischen Vielfalt dieses sehr produktiven Autors.
Das erste der drei erstmals 2001 im Verlag Edition D.B. Erfurt erschienenen Bücher ist „COWBOY Pitt“: Mysteriöses tut sich in und um Altenroda, einem Thüringer Dorf. So begegnen Pitt und Bernd, beide 12-jährig, im Wald einem rätselhaften Fremden, und Tage später stößt Pitt, der dem Dorfhirten beim Kühehüten zu helfen hat, auf Spuren, die zu einem verlassenen Bergbau-Stollen führen ... Beetz erzählt von Abenteuern einer Kindheit, zu der auch erstes Verliebtsein gehört - eine Geschichte, die in die Nachkriegszeit führt, doch nicht allein aus Nostalgie ihre Reize bezieht. Und es geht auch gleich spannend los:
„HÜPF-MANNLE
An diesem Nachmittag befanden sich Pitt und Bernd, zwei Jungen aus Altenroda, spät noch im Harzscharrersgrund. Sie waren Stunden vorher aufgebrochen, losgesockt im Waldläuferschritt, Pitt ausgreifend, Bernd auf kürzeren, leicht gekrümmten Beinen wie ein Dackel, der ab und zu einen Spurt einlegen muss. Am Ochsenborn hatten sie im Vorbeigehen „gewässert“, das heißt: das Rinnsal, das die Bergflanke herabkam, umgelenkt auf die Wiese, die Pitts Großeltern gehörte, und dann waren sie eingetaucht in den Wald. Hier kannten sie jeden Pfad, was nichts Besonderes war, hatten sich doch selbst die Holzabfuhrwege während des Krieges und in den beiden Jahren seit seinem Ende streckenweise unter Farn und Fichtenanflug verkrochen.
Vorigen Sommer war ein Orkan über die Höhen hinweggefegt. Hier im Wind- und Regenschatten der Berge hatte er, anders als an den Süd-West-Hängen, kaum gewütet. Dort wurde noch jetzt im Windbruch gesägt, mit Äxten gehackt, über die sich verschärfende Borkenkäferplage geklagt. Hier war es still in den Gründen, selbst im Hochsommer ein wenig kühl und bereits am späten Nachmittag dämmrig.
Pitt und Bernd hatten zu fischen versucht. Das war verboten, gewiss, aber wer befolgte schon solche Verbote! Hauptsache, man ließ sich nicht vom Förster erwischen, falls der sich hierher verirren sollte. Gefangen hatten sie bislang nichts, keine der fünf, sechs pfeilschnellen, silberschuppigen Forellen, die ihnen zu Gesicht gekommen waren. Das ärgerte sie und spornte sie gleichzeitig an. Immer weiter folgten sie dem Bach, der vor ihnen hersprang, sich zwischen Steilhängen hindurchwand, abbog in ein breiteres, steiniges Tal, den Harzscharrersgrund, ein Stück von niedrigem, dichtem Wuchs flankiert und dann wieder unter dunklen, Turm hohen Fichten.
„Da!“ Bernd wies zum Ufer gegenüber. Dort hatte der Bach den Hang ausgewaschen, und in der Nische, die entstanden war, verschwand zwischen Steinbrocken gerade ein silbriger, ellenlanger Schatten. „So groß“, flüsterte Bernd, wobei er wenigstens einen halben Meter anzeigte.
Pitt wiegte den Kopf. „Versuch's von unten!“, riet er. „Ich geh von oben ran.“ Hastig streifte er die Gummilatschen, die sein Großvater in der Tischlerwerkstatt aus einem alten Autoreifen gebastelt hatte, von den Füßen, und bedächtig, lautlos, sacht stieg er in das kalte, sprudelnde Wasser. Bernd behielt seine Igelit-Sandalen an, als er ein Stück Bach abwärts, mit den Armen balancierend, den glitschigen, steinigen Grund betrat. Plötzlich hörte Pitt über dem Gemurmel des Baches Gepolter.
Ein Tier? Ausgerechnet jetzt? Auch Bernd war stehen geblieben, den Mund beim Lauschen halb offen. Dort kam tatsächlich was. Oder irgendwer. Die Schneise drüben am Hang herab - leicht hinkend, wie es schien. Ein Mensch, ja, ein Mann mit einem Schlapphut. Jetzt trippelte, sprang er das letzte Stück, wobei etwas schepperte, landete auf dem Weg, der oberhalb des Baches vorbeilief. Wenn man sich duckte, vielleicht ...
Da aber hatte der Mann die Jungen, die wieder erstarrten, offenbar erspäht. Einen Moment sah er her, reglos, unter dem Hutrand im Licht, das durch die Kronen herabdrang, unkenntlich, und plötzlich griff seine Hand zum Gürtel und fuhr über das Gesicht, das gleich darauf pechschwarz war.
Weiter unten im Bach bewegte sich Bernd oder fing an zu zittern, und nun erst verspürte Pitt die Kälte, die in ihm hoch kroch, und Angst. Der Mann war mit ungleichmäßigen Schritten zurückgewichen. Jetzt nahm er einen Rucksack von der Schulter, richtete drohend etwas Längliches, Umhülltes wortlos auf Pitt, auf Bernd und zog sich, die Jungen unverändert im Blick-, im Schussfeld, weiter zurück auf dem Weg, bis er unvermittelt zur Seite sprang und in Gestrüpp verschwand.“
Das zweite der erstmals 2001 im Verlag Edition D.B. Erfurt erschienenen Bücher ist der Ferienkrimi „Insel der Piraten“: Es sollte ein Abenteuer-Urlaub werden, ein „Abenteuer-Ferien-Trip“, und tatsächlich war schon die Reise nach La Roca aufregend und abenteuerlich. Dann aber, angelangt auf dieser entlegenen Insel, befindet sich Falko, der 12-jährige Held, eines Nachmittags mit einer Blende vor den Augen, geknebelt und gefesselt, offenbar in einem Höhlenlabyrinth und fragt sich unter jähem Entsetzen: Was, wenn das kein Spaß ist, kein von Paps arrangiertes Abenteuer live? Beetz erzählt eine Geschichte, die hierzulande beginnt und in fremdländische Urlaubsgefilde führt. Dort schlägt die Exotik bald in einen Albtraum um, wird zu einem Abenteuer auf Leben und Tod. Gleich zu Beginn des Buches ist Falko offenbar in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten:
„IM DUNKELN
Nach wie vor weiß Falko nicht genau, ob er nur träumt oder das alles tatsächlich erlebt. Kneifen kann er sich nicht, wenigstens nicht richtig, schreien erst recht nicht; denn die Hände sind ihm gefesselt, und seinen Mund hat man kreuz und quer verklebt. Auch mit der Sicht ist es so eine Sache. Einer der Piraten hat dem Jungen ein Tuch vor die Augen gebunden, wahrscheinlich einen mehrfach zusammengefalteten Fetzen, in der Eile jedoch - oder vor Aufregung - die Enden nicht allzu straff verknotet. Jedenfalls konnte Falko nach dem Überfall, als er wieder auf den Beinen stand und der erste Schreck sich gegeben hatte, wenn er nach
unten sah, einen hellen Streifen und ein Stück von seinem karierten Wollhemd sehn.
Das ist jetzt kaum mehr möglich. Die Blende vor den Augen lässt nur noch einen Schimmer erkennen, einen unruhigen, hin- und herspringenden Schein, der vermutlich von einer Taschenlampe stammt. Nacht kann es nicht sein, auch nicht Abend. Als sie aufgebrochen sind, Falko und sein Vater, war es kurz nach neun, als sie überrumpelt wurden, noch immer Vormittag, und ohnmächtig geworden ist Falko, obwohl er mit dem Kopf aufschlug, keinen Moment. Also muss der Weg, der am helllichten Tag eine Taschenlampe erforderlich macht, weg vom Tageslicht führen, vermutlich in eine der Höhlen, von denen es auf dieser verkarsteten Insel, wie Falko weiß, jede Menge gibt. Anfangs ging es über einen Bergpfad, wie der Junge sie von Ausflügen mit seinem Vater her kennt, dann über schräge, leicht abschüssige Steinplatten, dabei aus Mittagssonnenschein hinein in die Dunkelheit. Nun, ein Stück weiter, wird's plötzlich unwegsam.
Bisher wurde Falko mit einem Strick an den gefesselten Händen geführt, außerdem durch kurze Zurufe dirigiert. Da hieß es befehlend mal „Fuß!“, mal „Achtung!“, mal „rechts!“ oder „links!“ - das alles in ein und demselben rauen, leicht heiseren, spanisch akzentuierten Deutsch und, wenn nötig, mit einem entsprechenden Ruck. Jetzt hört der Junge unvermittelt eine andere Stimme in der Landessprache. „Alto!“ Er ahnt, dass es gleichfalls ein Kommando ist, wohl „Stopp!“ bedeutet, reagiert aber zu spät und stößt an seinen Vordermann, den Führer.
Die Folge - ein unwilliges, nachträgliches „Halt!“ Dann redet der andere Pirat, vermutlich der Chef der beiden, der eine helle, überraschend melodische Stimme hat. Der zweite, der, dem Falko bislang arglos und - nach dem ersten Schrecken - sogar ein wenig abenteuerdurstig gefolgt ist, er erwidert etwas, das sich nicht gerade begeistert anhört, und plötzlich fühlt sich der Junge gepackt, hochgehoben und wie ein Sack über die Schulter geworfen.
Hehe! versucht er zu schreien. Vergebens. Die Lippen sind ja verklebt. Sie brennen unter dem Streifen, an dem sie gezerrt haben. Dabei geht es Falko durch den Kopf: Lustig ist das nicht gerade. Und dann erst, während er davongeschleppt wird, tiefer hinein in die Finsternis, fragt er sich unter jähem Erschrecken: Was, wenn das alles kein Spaß ist, kein von Paps arrangiertes Abenteuer live?“
Der Titel des dritten ebenfalls erstmals 2001 im Verlag Edition D.B. Erfurt erschienenen Buches mit Tiergeschichten lautet „Weihnachtshund und Bambusrüssel“: Sandra bangt um Adolar, ihren Wellensittich, Hanh um „Bambusrüssel“, den gezähmten Wildelefanten, Uli um den Hund, der unterm Tannenbaum saß, neben drei Teddybären, einem Gestiefelten Kater, zwei Kamelen ... Beetz erzählt Tiergeschichten, die zugleich Geschichten von Menschen sind, von Kindern und von älteren Leuten handeln. Was ihnen widerfährt und was sie erkämpfen - egal, ob hierzulande oder im vietnamesischen Bergland - all das ist anrührend und abenteuerlich, oft überraschend und auch deshalb spannend für jung und alt. Die erste Geschichte des Buches spielt im vietnamesischen Bergland:
„BAMBUSRÜSSEL
Einem Ausreißer hinterher
Schon oft ist Bambusrüssel, der junge, berühmte Elefantenbulle, verschwunden gewesen, aber noch nie hat sich Hanh solche Sorgen um seinen dickhäutigen Freund gemacht. Auch die anderen Treiber warten auf den Ausreißer und hoffen, dass ihm nichts zugestoßen ist.
Sie haben sich bei einem Flüsschen gelagert, gefährlich dicht am Wasser. Hier können die Elefanten zwar ihren Durst löschen, sich im Schlamm wälzen und sich an Geäst und frischem Grün gütlich tun, doch je länger die Kolonne an diesem Rastplatz verharrt, desto lichter wird das Laubdach und desto größer die Gefahr, aus der Luft erspäht zu werden.
Gerade erhebt sich wieder in der Ferne Lärm, ein anschwellendes Heulen, das rasch näher kommt. Der Vater von Hanh und die anderen Männer, die beratend zusammensitzen, verstummen und ducken sich unwillkürlich, und selbst die Elefanten nahebei im Bambusdickicht scheinen zu erstarren. Reglosigkeit unter den hohen Eisenholzbäumen, durch deren Kronen jetzt heulendes Pfeifen herabschallt. Augenblicklang meint Hahn, oben im Blau zwischen dem Laub und den Wolken metallisches Blinken wahrzunehmen. Mai bai - Flugzeuge, Bombenflieger. Der Junge kennt sie und weiß, dass sie weit hinter den Bergen aufsteigen, um ihre todbringende Last hier an der Grenze oder unten über den dichtbesiedelten Ebenen abzuwerfen. Er hat schon das Sirren vorbeischwirrender Splitter gehört, das Schreien, das Gebrüll verletzter Menschen, verwundeter Tiere. All das ist ihm bewusst, und doch denkt er dabei hauptsächlich an Bambusrüssel. Ob der still steht, sich versteckt hält? Oder haben ihn die da oben entdeckt? Klinken sie jetzt über ihm eine ihrer Bomben aus? Stürzt der Tod herab, rasch und immer rascher?
Dann sind die Düsenbomber weitergeflogen, landeinwärts. Ihr Lärm ebbt ab, aber still wird es nicht hier über den Bergen an der Grenze zwischen Vietnam und Laos. Von einem der Nachbar-Täler dringt Brummen her, wie es in letzter Zeit des Öfteren zu hören war. Vater und die Männer bei ihm haben den Kopf gehoben. Auch Hanh lauscht. Er denkt dabei an Flugzeuge, die langsam fliegen und rötliche Nebel versprühen - Gift, das sich auf Blätter und Gräser legt und alles verdorren lässt.
Plötzlich steht Vater auf, und die anderen erheben sich ebenfalls. Sie haben sich offenbar entschlossen, nicht länger abzuwarten, dass Bambusrüssel aus freien Stücken zurückzukehren geruht. Drei von ihnen sollen ihn suchen und hertreiben, damit die Elefanten endlich ihre Tragelasten wieder aufnehmen und den Marsch nach Süden fortsetzen können.
„Darf ich mitkommen?“, fragt Hanh.
Der Vater nickt, und so schließt sich der Junge ihm und den beiden anderen an. Ihr Weg führt zunächst am Ufer des Flüsschens entlang. Hier hat Bambusrüssel in der Frühe bei seiner Entfernung von der Kolonne deutliche Spuren hinterlassen, Tapfen, denen zu folgen kein Kunststück ist. Bald aber wird die Suche schwieriger. Vor einer Talenge, wo das Dickicht, dicht wie eine Hecke, bis an den Fluss heranreicht, ist Bambusrüssel einfach im Wasser weitergestapft, und nun steigt auch der Vater von Hanh, der Führer des Suchtrupps, in den Fluss. Die anderen tasten sich hinterher.
Kaltes, rasch fließendes Nass, glitschige Steine am Grund, auf denen die Füße wegrutschen, und eine Strömung, immer stärker, je enger das Tal wird. Endlich ist die Schlucht durchquert. Die Männer und Hanh staksen ans Ufer - an derselben Stelle, wo Stunden zuvor auch Bambusrüssel, vermutlich leichtfüßiger als sie, das Wasser verlassen hat.
„Dieser Dickschädel!“, schimpft Tschu, ein Mann, etwa so alt wie der Vater von Hanh, doch Quang, der Vierte im Suchtrupp, hebt die Hand. „Still!“ Sie haben sich bereits ein Stück von der Schlucht entfernt. Trotzdem ist hier noch das Rauschen der Strömung zu hören, und jetzt wird erneut jenes Brummen vernehmbar.
„Schon wieder Giftflieger“, sagt Quang.
„Schon wieder“, bestätigt Tschu.
Schweigend setzt der Trupp seinen Weg fort, nunmehr in einem anderen Tal, nach wie vor auf der Fährte von Bambusrüssel. Streckenweise hat der Elefant mit seinem Leib den Dschungel wie ein Panzer durchbrochen. Zwischendurch führt die Spur über Lichtungen oder über Geröll, wo sie sich fast verliert. Hinter den Baumkronen - bald nah, bald fern - dröhnen Flugzeuge.
Und dann bleibt der Vater von Hanh plötzlich stehen, um sich über Abdrücke am Boden zu beugen. Tschu, Quang und Hanh schließen auf, und auch der Junge mustert die Trittsiegel, die in Gras und Erdreich zurückgeblieben sind. Kein Zweifel, sie stammen von Elefanten, aber hier ist nicht nur Bambusrüssel dahingestapft. Vorher müssen andere Dickhäuter diesen Pfad gegangen sein.
„Sicher die Herde, aus der sich unser Ausreißer eine Braut holen will“, sagt Tschu.
Quang und Hanhs Vater schmunzeln, doch der Vater wird rasch wieder ernst. „Hoffentlich lockt sie ihn nicht all zu weit“, äußert er besorgt, „und hoffentlich wird er nicht von einem anderen Bullen verletzt!“
Dass Bambusrüssel auf Freiersfüßen geht, dass er deshalb den Dschungel durchstreift, ist Hanh nicht neu. Der Junge weiß auch, dass es sich bei den fremden Elefanten um wilde, ungezähmte Tiere handelt. Außerdem liest er von den Fährten ab, dass die Herde einigen Vorsprung hat. Wahrscheinlich befindet sie sich längst im nächsten oder übernächsten Tal, dort, wo noch immer Flugzeuge lärmen. Dann wird es still in der Ferne und still ringsum. Die Flugzeuge sind wohl davongeflogen. Weshalb aber schweigen die Vögel und selbst die Grillen?
Der Suchtrupp bewegt sich jetzt durch Dschungel, der merkwürdig licht wirkt. An den Bäumen und am Gestrüpp hängt zwar noch das Laub, doch die Blätter haben sich zusammengerollt. Sie sehen welk aus. Auf einem Zweig erblickt Hanh einen Schmetterling. Er streckt die Hand aus, berührt den Falter und hört die Stimme seines Vaters. „Nicht anfassen!“ Der Schmetterling hat sich gelöst. Leblos fällt er zu Boden.
„Hier ist alles tot, alles vergiftet“, sagt Vater. Tschu steht vor einem Baum, dem Äste abgerissen worden sind, Äste in Rüsselhöhe. Die Rissflächen glänzen feucht von ausgetretenem Harz. Sie sind sicher erst wenige Stunden alt.
„Weiter!“, drängt Vater. „Wir müssen ihn einholen, bevor er zu viel davon frisst.“
Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen den Tod. Die Männer und der Junge hasten auf der Fährte, die Bambusrüssel hinterlassen hat, voran und halten nicht einmal inne, als wieder Bomber über ihnen hinwegdonnern. Jede Rissstelle, an der sie vorbeikommen, steigert ihre Besorgnis und treibt sie an.
„Ich versteh nicht“, stößt Quang hervor, „dass er so viel gefressen hat. Wo er doch hinter einer Braut her war!“
„Gerade deshalb“, erwidert Tschu. „Sind sie dann nicht alle leichtsinnig und gierig?“
Stimmt, gesteht Hanh in Gedanken ein, und doch stört ihn, dass Tschu Bambusrüssel anderen Dickhäutern gleichstellt. Ist Bambusrüssel nicht ein besonderer, ein einmaliger Elefant?“
Erstmals 2002 erschien im Verlag Edition D.B. Erfurt „Die Gräfin und der Spielmann“ – ein Märchenbuch, das zwei Autoren hat, die direkt miteinander verwandt sind: Karl Otto Beetz und Dietmar Beetz: Karl Otto Beetz, geboren 1859 in Neustadt am Rennsteig und gestorben 1940 in Gotha, war nach seinem Studium Lehrer unter anderem in Halle an der Saale, ab 1898 Schuldirektor und ab 1903 Bezirksschulinspektor in Gotha, redigierte jahrzehntelang „Die pädagogische Warte“, gab die Sammlung „Bücherschatz des Lehrers“ heraus, veröffentlichte Erzählungen, Sagen, die Autobiographie „Ausfahrt und Heimkehr“ sowie die Märchensammlung „Urd“, welche zwischen 1889 und 1930 mehrere Auflagen erlebte und seinerzeit viel gelesen wurde.to Beetz wurde 1859 in Neustadt am Rennsteig geboren. Nach dem Studium war Beetz Lehrer in Halle/Saale, ab 1898 Schuldirektor in Gotha und ab 1903 Bezirksschulinspektor in Gotha. Er war Redakteur der Zeitschrift »Pädagogische Warte« und Herausgeber des »Bücherschatzes für Lehrer«. Ab 1921 arbeitete er für die Thüringer Regierung in Weimar. Er starb um 1930 in Weimar.
Karl Otto Beetz wurde 1859 in Neustadt am Rennsteig geboren. Nach dem Studium war Beetz Lehrer in Halle/Saale, ab 1898 Schuldirektor in Gotha und ab 1903 Bezirksschulinspektor in Gotha. Er war Redakteur der Zeitschrift »Pädagogische Warte« und Herausgeber des »Bücherschatzes für Lehrer«. Ab 1921 arbeitete er für die Thüringer Regierung in Weimar. Er starb um 1930 in Weimar.
Dietmar Beetz, sein Urgroßneffe, der 1939 ebenfalls in Neustadt am Rennsteig und sogar im selben Haus wie sein Ur-Großonkel Karl Otto geboren wurde, hat jetzt 10 Märchen dieser Sammlung neu gefasst, zum Teil auch neu gestaltet. Entstanden sind so Texte, die da und dort entfernt an Vertrautes erinnern, dabei aber durchaus Eigenständigkeit besitzen. Und die im Übrigen voller Spannung sind - und nicht ohne Humor. Wie man gleich am ersten dieser Märchen leicht erkennen kann, in dem uns jemand begegnet, der die Ratschläge seiner Mutter sehr ernst nimmt:
GLÜCKSMICHEL
„Du bist ein Glückskind“, sagte die Mutter zu Michel, ihrem einzigen Sohn, „und du hast mir immer gehorcht. Bitte, tu's auch jetzt! Geh ins Dorf und such dir eine ordentliche Frau!“
„Wird gemacht“, erwiderte Michel und wandte sich zur Tür.
„Moment noch!“, rief die Mutter. „Dass du mir aber nicht rumstehst oder rumhockst und bloß gaffst! Tüchtig zugegriffen und gegessen, wenn sie dir was anbieten sollten!“
„Zugegriffen und gegessen!“, wiederholte Michel und marschierte los - auf Brautschau.
„Na“, fragte die Mutter, als er munteren Schrittes zurückkam, „wie war's?“
„Nicht schlecht“, gab er zur Antwort. „Dumm eigentlich nur, dass ich Gras essen musste wie eine Kuh.“
„Gras - essen?“
„Ja doch! Den Blumenstrauß, den das Gretel mir gegeben hat, lauter Margeriten, Arnika, Vergissmeinnicht ... Hab ich gekaut und geschluckt und gekaut!“
„Aber, Michel, Blumen zu verspeisen - wer hat dich denn auf die Idee gebracht?“
„Na, du, Mutter! 'Tüchtig zugegriffen und gegessen, wenn man dir was anbieten sollte!' hast du gesagt, und ich hab's gemacht.“
„Hm ... Und das Gretel, die - Grete?“
„Die hat gelacht, mich ausgelacht.“
„Lass sie!“, sagte die Mutter nach einem Seufzer. „Musst halt noch eine Menge lernen. Blumen – das merk dir! - einen Strauß, den man auf Brautschau geschenkt kriegt, den isst man nicht, den steckt man sich an den Hut. Verstanden?“
„Klar, Mutter. Nicht essen - an den Hut stecken!“
„Gut. Und nun los und ein paar Häuser weiter dein Glück versucht!“
Diesmal klopfte Michel an bei der Liese, die er noch immer „Liesel“ nannte, obwohl sie mittlerweile zu einer jungen Frau herangewachsen war. Sie kochte gern und gut und servierte ihm deshalb nach einigem Gesprächsgeplänkel einen Mehlkloß mit herrlich duftender Zwetschkenbrühe.
Michel schnupperte, leckte sich die Lippen und griff nach der Gabel, besann sich dann aber. „Denkst wohl, ich weiß nicht, was sich schickt?“, sagte er zu Liese, die ihn erwartungsvoll ansah. Und ohne eine Erwiderung abzuwarten, spießte er den Kloß auf die Gabel, steckte sich dieselbe an den Hut und goss die Brühe auf die Krempe.
Liese hatte die Handgriffe mit wachsendem Befremden verfolgt. Nun lief sie kreischend davon, verschwand und ließ Michel ratlos zurück.
Doch erst der Empfang daheim! Die Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, lachte und weinte beim Anblick ihres Sohnes, klagte. „Was soll nur aus dir werden? - Steckst dir einen Kloß an den Hut, an den Hut einen Kloß! Wenn ich da an deinen Vater denk, dem ich, als er um mich anhielt, gleichfalls Klöße serviert hab ... Halbiert hat er jeden und die Hälften nochmals sorgsam geteilt und jedes Viertel manierlich verspeist wie ein feiner Herr.“
Das kann ich auch, sagte sich Michel, und tags darauf ging er wieder auf Brautschau, abermals ein paar Häuser weiter, zu Katrin, die er schon als „Trinchen“ gekannt hatte. Diesmal brachte ihm die Umworbene ein Linsengericht - Linsen, von denen es hieß, wer sie esse, dem gehe nie das Geld aus. Michel mochte Linsensuppe zwar nicht sonderlich, doch riss er sich zusammen und fragte verschmitzt: „Meinst wohl, ich könnte nicht speisen wie ein feiner Herr?“
Katrin guckte verständnislos.
Da schob Michel den Löffel beiseite, langte nach Messer und Gabel und begann, jede Linse in Viertel zu schneiden. Er gab erst auf, als Katrin ihm lachend riet: „Geh, Michel, bitte, geh! Such dir die feine Dame, die zu dir passt!“
„Bist zwar ein Glückskind“, stellte daheim die Mutter bekümmert fest, „aber zum Heiraten offenbar noch zu dumm. Ich habe dich, meinen Einzigen, stets vor Widrigkeiten geschützt, doch nun musst du wohl oder übel in die Welt gehn, dich gründlich umsehn und lernen, dich endlich allein durchzuschlagen.“
Michel nickte. „Wenn's sein muss ...“
Die Mutter seufzte und füllte für ihn drei Töpfe mit Proviant. In den ersten drückte sie Butter, in den zweiten Quark, den dritten goss sie voll Milch. „Nun wende alles gut an!“
„Werd ich schon“, versicherte Michel – und marschierte los, auf Wanderschaft. Bald kam er an ein Wegstück, das von einem Gewitterguss aufgerissen worden war. Was, wenn jemand in diesen Spalt tritt, stolpert und stürzt? ging es ihm durch den Kopf, und er griff in sein Bündel, öffnete den ersten Topf und strich die Butter in den Riss, damit das Wegstück wieder gefahrlos passierbar war. Bald darauf gelangte er an einen schilfgesäumten, von dichtem Gestrüpp umstandenen Teich. Dort probte gerade ein Frosch-Chor. „Quak, quak!“, schallte es dem Wanderburschen entgegen.
„Wenn ihr sonst nichts wollt“, erwiderte der, holte den zweiten Topf aus dem Bündel und warf eine Handvoll Quark nach der anderen ins Wasser, zwischen die verwundert verstummenden, weghüpfenden, abtauchenden Frösche. „Gell, das schmeckt? - Na, wohl bekomm's!“
Da es schon dämmerte, beschloss Michel, hier am Ufer die Nacht zu verbringen, und weil es kühl zu werden begann, suchte er dürres Holz zusammen und zündete sich ein Feuer an. Bald prasselten die Flammen, und bei einem Blick in die Glut sagte sich Michel: Eigentlich habe ich mich bisher allein ganz manierlich durchgeschlagen. Schlief er ein dabei? Träumte er dann? Plötzlich sah er eine weiße Schlange aus dem Schilf gekrochen kommen. Sie näherte sich ihm, hob den Kopf und züngelte, züngelte ihn an.
„Armes Tier“, sagte Michel im Traum oder tatsächlich im flackernden Schein seines Feuers, „hast sicher Durst. Wenn du magst - hier ist Milch, ein ganzer Topf voll. Trink nur, trink dich satt!“
Und sie trank, trank, bis sie gesättigt im Gras lag, reglos, wie erstarrt.
„Ist dir kalt?“, fragte Michel. Er berührte sie, spürte, wie kühl sie war, griff zu und sagte: „Komm, ich wärme dich; sonst erfrierst du mir noch.“ Da aber entglitt sie ihm und fiel ...
Er schrak auf, hielt die Luft an, erstarrte. Ins Feuer war sie gefallen, ins Feuer hier am Ufer dieses Teiches, und nun - nun stiegen Dämpfe auf, weiße Dämpfe, die dicht und dichter wurden, bis plötzlich ein Donnerschlag erdröhnte.
Vor Schreck fiel Michel auf den Rücken und schloss die Augen. Als er sie wieder aufschlug, stand vor ihm ein Mädchen, eine wunderschöne, junge Frau. Sie hielt ihm die Hand hin, sagte: „Komm, Michel, steh auf!“
„Wer bist du?“, fragte er. „Wo kommst du her?“
Sie wies in die Runde, zu Gärten und zu einem Park, die im Mondschein lagen, zu einem Schloss mit hell erleuchteten Fenstern, aus denen Licht auf Kutschen und Pferde, auf geschäftige Menschen fiel. „Das alles war eben noch ein Froschteich mit Schilf und Gestrüpp weit im Umkreis, verwunschen, von einem bösen Zauber gebannt.“
„Und die Schlange, die weiße Schlange?“
„Das war ich - verhext mitsamt meinem Gesinde, meinem Schloss, meinem Land. Du hast uns erlöst, und nun gehören wir - gehört das alles dir.“
„Alles?“ Michel richtete sich auf. „Auch - du?“
„Wenn dein Herz noch frei ist ...“, erwiderte die Prinzessin lächelnd.
„Mein Herz ... Ach, was! Wenn du mich magst, gehör ich dir mit Stumpf und Stiel. – Sagt man so?“
„Warum nicht, Michel, warum nicht?“
„Gut. Dann lass uns meine Mutter holen, auch die eine und die andere aus unserm Dorf! Sollen alle mit uns Hochzeit feiern!“
Erstmals 2003 erschien im Verlag Edition D.B. Erfurt „Räuber - Hexe - Monster – Teufel. Geschichten für alt und jung“: Am Waldrand nördlich von Neu-Cehheim hausen vier suspekte Gestalten, für die sich die Polizei interessiert - und am Rande eines Städtchens namens Mecka lebt eine erstaunlich unspektakuläre Familie, die gleichfalls Besuch erhält. So der Auftakt zu zwei Geschichten, die unterschiedlicher kaum denkbar sind und doch verwandt erscheinen; und auch die Reimerei dazwischen („Fünfmal Vers-Salat“) ist programmgemäß sowohl „schrecklich lustig“ wie „furchtbar spannend“. Aber wie erzählt man eigentlich so eine Geschichte? Wie stellt man es an? Hier der Beginn der ersten der beiden Geschichten:
„RÄUBER - HEXE - MONSTER - TEUFEL
Eine Geschichte erzählen? Hm ... Und was für eine, bitte? - Eine schreckliche, die auch ein bisschen lustig ist, außerdem natürlich furchtbar spannend? Gut, warum nicht? Erzählen wir einander also eine schrecklich lustige, furchtbar spannende Geschichte!
Zunächst die handelnden Personen! Wer soll in unserer Geschichte eine Rolle spielen?
Eine Hexe, einverstanden. Keine moderne Geschichte oder Story kommt ohne Hexe, ohne Zauberei aus. Was noch?
Ein Räuber, richtig! Raubritter, Schnapphähne, Freibeuter - die gehören einfach dazu; das sind schließlich die Helden unserer Zeit.
Ein Monster? Hm ... Stimmt schon; wo man hinguckt oder hinhört - nichts oder fast nichts, das nicht gewaltig und missgestaltet, eben monströs wirkt. Autoschlangen und Müll, Hunger dort, Verschwendung hier ... Das ist schrecklich, klar, und wird, wie's aussieht, immer schlimmer; aber sollte unsere Story nicht auch - wenigstens ein bisschen - lustig sein? Ein liebes, ein gutmütiges Monster, das könnte passen. Wie wär's mit einer Kreuzung aus Katze und Hund, einem Katzenhund, der - sagen wir mal: Mia Wau heißt, dreieinhalb Zentner wiegt, schon alt und hinfällig ist und nur, wenn's ihm in den Kram passt, schnurrt oder grimmig knurrt?
Schön, da hätten wir also zu Räuber und Hexe ein Monster, ein schrecklich liebes Ungeheuer.
Ein paar Gute? Natürlich gehören auch die mit rein in die Geschichte. - Prima, nehmen wir Polizisten! Beziehungsweise, weil sich das schöner anhört, „Schandar- me“, am besten zwei. Oder, weil die Bullen - Pardon! -, weil die Gendarmerie, Polizei oder Polente so ergreifend mutig ist, sicherheitshalber drei. - Genug Figuren fürs Erste?
Wozu denn einen Teufel? - Ach so: als Schurken, als Bösewicht, bei dem jedermann/frau auf Anhieb weiß: Das ist der - nein: das wirklich-echt-total-undgänzlich Schlechte. Hm ... Hat wohl zu sein, so ein Böser, damit die Guten besser weg und zur Wirkung kommen; ob's aber unbedingt ein waschechter Teufel sein muss ...
Okay, okay; der Teufel ist ja gebongt! Aber vielleicht taucht zusätzlich zu gegebener Zeit ein Lump auf, ein übler, schuftiger Erz-Malefiz-Halunke, dem niemand sofort die kohlpechrabenschwarze Schurkenseele ansieht. Oder einer, den alle Welt (und der sich selber) für supergut hält. Ja, und was unseren Teufel betrifft: Wenn wir den gleich am Anfang mit auftreten lassen, als Fremdling, dem noch der Durchblick fehlt, als eine Art Gast der Hexen-Räuber-Monster-Gang ...
Nichts ist. Hab nur überlegt, wie's losgehn soll. Also, hör zu und stell dir vor: Dort ist ein Wald, einer wie der hinter der Stadt, draußen bei den Dörfern, die Achleben, Bähstädt oder Cehheim heißen. - Bei so 'ner Eigenheimsiedlung, genau. Oder - noch genauer - in Sichtweite einer dieser Grundstückskolonien, wo sich Füchse und Marder gute Nacht sagen (oder doch vormals gesagt haben) und wo seit eh und je auch Räuber und Hexen, Monster und Teufel ihren traditionellen, neuerdings zunehmend unzeitgemäßen Unterschlupf haben.
Wenn die hier vorbeikommen, die Vier unserer Gang, und wir als ihre unsichtbaren Begleiter, egal, ob am Morgen, tagsüber oder, wie jetzt, gegen Abend, dann wirkt Neu-Cehheim auf uns, ähnlich wie Bähstädt-Wald oder Achleben-West, immer merkwürdiger, von Mal zu Mal gespenstischer. Keine Kipper mehr, die knurren oder rumoren, kein großmäuliger Bagger, der knirschend ins Erdreich beißt; nicht mal mehr das beglückende Kreischen einer Schlag-Bohrmaschine - beglückend, weil es dich an den Zahnarzt erinnert, du aber hier vorbeigehst oder verharrst und nicht irgendwo dort drüben auf einem Zahnarzt-Bohrstuhl hockst. All die herrlichen Baugeräusche - passé. Verstummt auch das gebändigte Grummeln der Möbeltransporter. Nur ab und an das Räuspern eines Rasenmähers, das Klacken einer Autotür, das Rasseln einer Jalousie.
Merkwürdig aber, ja, beinah gespenstisch erscheint dir, dass selbst zu diesen seltenen Lauten kaum mal jemand zu sehen ist. Kann sein, du erspähst, wenn du vorbeischlurfst auf dem unlängst asphaltierten, einstigen Feld-Hain-und-Wiesen-Weg, eine Gestalt oder einen Schatten an einem der Doppelfenster, hinter einem der stachelgekrönten Maschendrahtzäune oder zwischen dem frisch angepflanzten, schütteren Ziergehölz, doch falls irgendwer dort rumsteht oder rumwerkelt, scheint er taub zu sein oder Grüße zu ignorieren.
Plötzlich fängt Mia Wau zu knurren an, und nicht nur das. Der Katzenhund ist mitten in seinem Watschelschritt erstarrt, und nun sträubt sich das wolfsgraue Fell. Auch die anderen Mitglieder der Gang sind stehengeblieben, wir gleichfalls. Alle gucken wir, spähen, suchen, und da entdecken wir zwei grünliche Augen mit schlitzschmalen Pupillen. Aus dem schütteren Gestrüpp einer schuppenblättrigen Tamariske starren sie her, reglos, drohend, unheimlich. Katzenaugen, die Mia Wau, unseren Katzenhund, wie's aussieht, in Angst versetzt haben, ja in Panik treiben.
Und das will ein Monster sein? denkst du noch; da bemerkst du, wie sich die Hexe einen Ruck gibt, wie sie die linke Hand hebt und mit Daumen und Mittelfinger schnippt. Waren das Funken eben, vorn an den Fingerspitzen, Funken wie von einem Feuerzeug? Und die Lippen - haben sich die bewegt? Hat die Hexe was gemurmelt?
Wie auch immer - im nächsten Moment sind die grünlichen Augen verschwunden. Weg, fortgehext oder - was weiß ich? - verschluckt von der Dämmerung, die sich auf dem Mulch unter der Tamariske breitmacht. Gleich darauf bricht das Geknurre ab, verstummt das Monster. Räuber und Hexe wechseln einen Blick und seufzen, als hätten sie so was schon mehrfach erlebt, und eigentlich ist die Sache damit erledigt.
Was denn nun noch? - Ach so: der Krauter dort neben den Koniferen, der Alte, der vorhin rumgeharkt und die Grüße der Gang ignoriert hat. - Stimmt, gefällt auch mir nicht, wie er dasteht und herguckt. Und sich jetzt wieder an seinem Mistbeet - oder was er da unterm Karst hat - zu schaffen macht. Komm schon; lass diesen Stiesel, wenigstens vorerst! Trotten wir weiter mit, brav hinter den anderen her, zunächst mal bis zu dem Grenzstein dort, wo der Asphalt aufhört und der Feld-Hain-und-Wiesen-Weg für Fortsetzung sorgt. - So, und jetzt fix einen Blick über die Schulter!“
So und jetzt wissen Sie einigermaßen Bescheid, wie man so eine Geschichte anfängt. Und Sie haben hoffentlich einen kleinen Eindruck von der Vielfalt der li