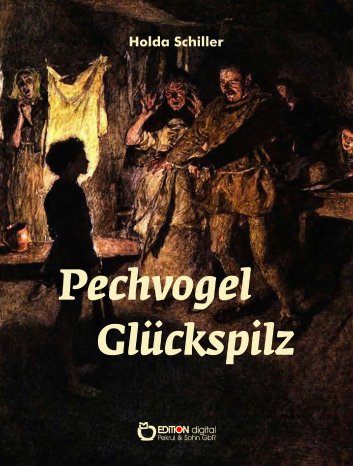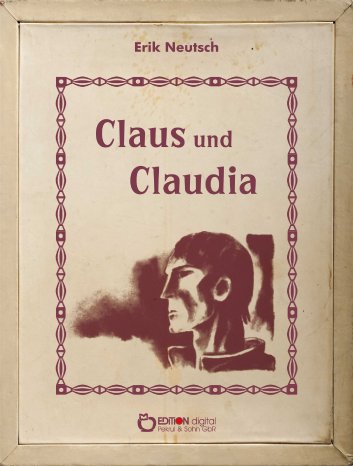So muss sich der Kennedy-Anhänger und neue US-Botschafter in Santo Domingo, Henry Walter Mitchell, erst noch in seinem Gastland zurechtfinden. Der Hampelmann und fröhliche Tänzer Friedolin sieht, dass sich die beiden Jungen Tim und Wim in eine falsche Richtung entwickeln und kann zumindest anfangs scheinbar nichts dagegen tun. In der ägyptischen Wüste kämpft Karawanenführer Ahmed mit einer Spezialtruppe zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels. Und ein DDR-Botschafter muss sich in seinem Heimatland plötzlich mit unglaublichen Vorwürfen auseinandersetzen, die seine Tochter erhebt. Kann das wirklich so stimmen, was Claudia da behauptet? Will man sie wirklich fertigmachen? Ein noch immer aktuelles Buch über Anmaßung, Opportunismus, gar Feigheit und deren Mechanismen.
Erstmals 1982 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Der Brillenindianer“ von Hildegard und Siegfried Schumacher: Otto alias Häuptling Adlerauge ist mit seinen Eltern in eine andere Stadt gezogen. Dort, in dem Wald hinter dem Neubaugebiet, findet er auf einem seiner Streifzüge eine geheime Burg, die drei größere Jungen sich errichtet haben. Ihr Häuptling Branco nimmt Otto in die Bande auf. Warum Bande, fragt sich Otto, dann sind sie ja gar keine Indianer. Tatsächlich zwingen sie Otto zu Dingen, die nichts mit seiner Indianerehre zu tun haben. Als er auch noch in einen Kaufhallendiebstahl verwickelt und seine Brille gestohlen wird, sucht er die Unterstützung seiner Eltern. Doch ganz allein mit seiner Freundin Antje will er die drei Großen zur Rede stellen. Hier zur Einstimmung das ganz kurze 1. Kapitel und ein längeres Stück des 2. Kapitels:
„1. Kapitel
Hast du jemals einen Indianer mit Brille gesehen? Du kennst doch Indianerfilme noch und noch, und was sahst du da? Geritten wurde, geschossen, geschlichen, geschwommen, Friedenspfeife rauchte man, grillte ganze Bären am Spieß, Tomahawks wirbelten durch die Luft, scharfäugig spähten Indianer nach dem Feind aus, oder sie blickten voller Verachtung vom Marterpfahl auf ihre Gegner. Eine Brille aber, nein, eine Brille trug niemand! Es hatte auch keiner Sommersprossen. Niemand lag einfach so auf der Wiese und träumte in die Wolken. Und hast du auch nur einen gesehen, der am Fluss saß und rein zum Spaß die Beine ins Wasser baumeln ließ? Unmöglich — sagst du, und du kennst dich mit diesen Filmindianern aus —, da kommen weder Wolkenträumer noch Beinebaumler vor, und eine Brille — sagst du —, wie sieht denn das aus: Federkrone, Adlerblick und ’ne Brille davor! Außerdem gibt es von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf der Prärie keinen Optiker, das weiß doch jeder, und jedermann weiß auch, Indianer haben fortwährend kühn und unheimlich aktiv zu sein. Aktiv ist unser Indianer. Er rennt — nein, er hüpft gerade die Treppe hinunter, und obwohl gar nicht Frühling, sondern herrlich heiße Sommerzeit ist, pfeift er „Alle Vögel sind schon da“. Mal wirft er das linke, mal das rechte Bein beim Hüpfen vor.
Das ist kein echter Indianer! Er sieht nur so aus. Aber dich kann er nicht täuschen, schon darum nicht, weil er eine Brille trägt und, statt zu schleichen oder sich sonst nach weit und breit bekannter Indianerart fortzubewegen, vergnügt vor sich hin pfeifend Stufe für Stufe abwärts hopst. In einem Neubau dazu! Nein, und hätte er sich sieben Häuptlingsfederkronen auf den Kopf gestülpt, dich täuscht er nicht! Der nachgemachte Indianer ist Otto aus dem fünften Stock.
2. Kapitel
Gestern war Otto eingezogen im Neubaublock am Stadtrand von Eichberge. Natürlich nicht allein, sondern mit seinen Eltern und Elle, der kleinen Schwester. Das heißt, Elle war einstweilen bei Onkel Udo und Tante Gitta in Drosseldorf. Kleine Kinder stören beim Umzug. Otto sollte auch dort bleiben. Er hatte abgelehnt und seine Armmuskeln spielen lassen, der Vater musste sie abfühlen, und dann hatte er beschlossen: Gut, weil Onkel Udo der Ernte wegen beim Umzug ausfällt, machst du mit. Ein bisschen hilft es doch.
Ein bisschen! Darüber konnte Otto nur lachen. Er hatte sich nicht geschont, war treppauf, treppab gelaufen, hatte keuchend Kisten und Kasten geschleppt, an die zehn Liter Schweiß verloren und zum Ausgleich mindestens zehn Brausen getrunken. Todmüde war Otto abends ins Bett gefallen. Auch am Morgen blieb noch viel zu räumen und einzurichten. Trotzdem hatte die Mutter ihm beim Frühstück zugeredet: „Guck dich draußen um, geh spielen, Junge!“ Zuerst wollte Otto das weit von sich weisen. Wie gesagt, er war ja kein kleines Kind wie Elle, aber nach kurzem Überlegen gelangte er zu der Einsicht, dass man Eltern nicht durch zu große Hilfsbereitschaft verwöhnen dürfte. Also hatte er sich dem Willen der Mutter gefügt und war in seiner Indianeruniform samt Pfeil und Bogen und Kriegsbeil frohgemut abgezogen. Die Sonne schien, wie es sich in den großen Ferien gehört, die Eltern hatten ihre Beschäftigung, und Otto fühlte sich frei, so frei wie ein Adler in den Lüften. Was kann der Mensch mehr verlangen!
Otto hatte seine Indianeruniform bisher nur in Drosseldorf getragen. Dort hatte er eine Menge Freunde, und der Wald begann gleich hinter der Wiese, die an den großen Garten grenzte. Es war nur ein Katzensprung ins freie Indianerleben mit den Drosseldorfer Rothäuten. Während der Schulzeit war an solch ein Leben nicht zu denken gewesen. Otto hatte vor dem Umzug auch in der Stadt gewohnt. Links lauter hohe Häuser, Typ 1900, rechts dasselbe, unten Geschäft an Geschäft und vor der Nase der Busbahnhof. Dort passten Indianer wie er und seine Stammesbrüder aus Drosseldorf nicht hin. Schade, dass die Freunde so weit weg wohnten, denn hier in Eichberge lag der Wald genau wie bei Onkel Udo und Tante Gitta hinterm Haus, sogar noch dichter. Vom Balkon im fünften Stock hatte Otto direkt in die Baumkronen gucken können. Endlich im Grünen! Die Mutter freute sich, doch der Vater hatte gesagt, dass in den nächsten Jahren abgeholzt und weitergebaut werden sollte. Vorläufig fehlte jedes Anzeichen dafür, weder Planierraupen noch Turmdrehkran und Zementsilo. Jahre — eine Ewigkeit.
Vor der Haustür lag kein Indianerland. Überall machten sich Sandberge breit. Bis zur festen Straße füllte man sich die Schuhe voll. Otto fand, die Gegend vorm Haus sah nach halbhohen Ostseedünen aus, nur das Meer war nicht da. An seiner Stelle reihte sich Neubau an Neubau, und wo ihre Balkons die erste Sommerbleiche hinter sich hatten, durchquerten rechteckig angelegte Plattenwege und abkürzende Trampelpfade die Rasenflächen. Dahinter die große Kaufhalle und der Komplex mit Sparkasse, Friseur und Restaurant. Zivilisation also und uninteressant.“
Unter dem Titel „Der Resident“ erschien erstmals 1973 beim Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig der 2. Band der Dominikanischen Tragödie von Wolfgang Schreyer: Santo Domingo, 1962: nur drei der Trujillo-Attentäter haben den Untergang des barbarischen Regimes erlebt. Sie schicken sich an, auch den alten Familien die Macht zu entreißen - kühn, um dem Land zu dienen, oder selbstsüchtig, skrupellos. Da kommt auf die karibische Insel der neue US-Botschafter, ein Amateurdiplomat und Mann John F. Kennedys. Im Geiste der „Allianz für den Fortschritt" will er den Streit schlichten, die Dominikaner Demokratie lehren. Industriegigant und Bananenrepublik - zwei Welten prallen aufeinander, beide vital, doch zerrissen und defekt. Washington sucht die Entwicklung zu steuern, elegant und energisch ein südliches Schaufenster zu errichten, das die kubanische Herausforderung überstrahlt. Wird dem Botschafter dies glücken? Trotz privater Sorgen ist er ein Mann von bedeutender Schlagkraft, Redlichkeit und Frische. Gewinnt er diesen Mehrfrontenkrieg - den Kampf gegen die revolutionäre Stimmung, gegen das Komplott der Superreichen und seine internen Feinde? Das Buch zeigt Menschen mit ihren Hoffnungen und Begierden, der uralten Jagd nach Glück, Reichtum, Liebe, Karriere, Befriedigungen jeder Art ... Eingepfercht in Machtmechanismen und das Geflecht persönlicher Verstrickung. Die Ereignisse zeichnet es nach Dokumenten und der Erinnerung von Augenzeugen; ohne eine Spur von Schwarzweiß. Von den tropischen Schauplätzen führt der Roman bis in den obersten Stock des State Departements und in das Weiße Haus. Seine Kraft liegt in der Verknüpfung politischer Abläufe mit dem Schicksal der Handelnden, ihrem seelischen Mikrokosmos, umbrandet vom Strom der Zeit. Das packt wie die Dramatik des abenteuerlichen, hier so kühl und wahrhaftig erzählten Geschehens. Gleich zu Beginn begegnen wir dem neuen amerikanischen Botschafter auf der Fahrt zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens:
„Erstes Kapitel
1
Als Henry W. Mitchell an jenem sonnigen Märzmorgen in den Wagen stieg, einen schwarzsilbernen Cadillac mit pompösen Heckflossen, war es schon recht warm. Wohl hatten die Zeitungen gewarnt: Achtung, Kälte, Nachttemperatur um 14 Grad! Aber solche Zahlen bedeuteten in Santo Domingo stets Celsiusgrade über Null. Er musste sich eben daran gewöhnen, die Presse gewissenhaft zu lesen, ganz anders als zu Hause in den Staaten; und zwar in jeder Hinsicht. An so vieles musste er sich jetzt gewöhnen! Hier begann ja ein neues Leben. Der diplomatische Dienst verlangte Selbstzucht, kühlen Realismus. Aber was für ein Genuss, Einfluss zu haben, als Staatsmann zu handeln und den Wirkungen nachzuspüren. Für einen Mann wie ihn, den Schreibtischarbeiter – scheinbar dazu bestimmt, im Hintergrund zu bleiben –, war dies vielleicht das Höchste.
Mitchell war 44, sah aber jünger aus durch das volle wellige Haar oder seine impulsive, verbindliche Art zu reden. Er hatte noch nie im Staatsdienst gestanden. Zeit seines Lebens war er Publizist gewesen, ein liberaler Intellektueller. Ungezählte Berichte und Magazingeschichten hatte er verfasst, dazu Bücher über den Strafvollzug, die Rassenfrage und den Bürgerrechtskampf; viermal war ihm der Benjamin-Franklin-Preis für den besten Artikel des Jahres verliehen worden. Er war Adlai Stevenson und John F. Kennedy in den Wahlkampf gefolgt. Und nun, dreizehn Monate nach Kennedys Amtsantritt, ging er als Botschafter in ein Land, das er von zwei Reisen her ein wenig kannte... Es war Freitag, der 9. März 1962. Die Vereidigung in Washington lag eine Woche zurück, seine Ankunft hier fünf Tage. Und doch war schon so viel geschehen, was seine Erwartungen enttäuscht oder auf bizarre Art übertroffen hatte.
Zu seiner Linken saß ein schlanker, brünetter Mann, der Chef des dominikanischen Protokolls. Der war mit sechs Regierungswagen in der Calle Leopoldo Navarro vorgefahren, um ihn und zehn seiner Gehilfen von der Residenz abzuholen. Wagen ohne Regierungsnummer, geschützt durch Sicherheitsbeamte. Sie mieden den kürzesten Weg zwischen der Botschaft und dem Nationalpalast, huschten ohne Eskorte durch das Lugo-Viertel. Denn am Vortag hatten Aufrührer mehrere Autos der Botschaft und auch des Konsulats zerstört, sogar Mitchells eigenen Wagen. Die Kolonne glitt hastig vorbei an weißen Gartenmauern, an den Barockfassaden der Villen. Polizisten verschafften ihr überall freie Fahrt – mit winzigen Gebärden, die daheim eher das Gegenteil bedeutet hätten: die Handfläche zum Fahrer ausgestreckt, die Finger gekrümmt, als ob sie einen Apfel hielten, das hieß weiterfahren. Passanten blieben stehen, starrten den Limousinen nach. Das war die neue Freiheit, libertad nueva; zu Trujillos Zeiten hätte niemand es gewagt, Staatspersonen anzustarren, da hielt man den Kopf gesenkt. Und überall, auf Mauern, Bordsteinen und Bäumen, die Parolen der Parteien. Auch das war libertad: Trujillo hatte nur eine Partei gekannt – seine eigene.
In Mitchells Brusttasche steckte das Beglaubigungsschreiben. Ein bedeutsames, doch schwerlich ganz ernstzunehmendes Dokument. Er hatte, gedrängt von Caroline, schon im Flugzeug die Durchschrift gelesen, beeindruckt und belustigt. Ein Hauch des 18. Jahrhunderts entstieg dem formelhaften Brief. Er trug Präsident Kennedys Unterschrift und sprach dessen Überzeugung aus, dass Henry Walter Mitchell fähig sein würde, sowohl die Interessen der Vereinigten Staaten als auch die der Dominikanischen Republik zu wahren. „Hoffentlich hat er recht“, hatte Mitchell zu Caroline gesagt... Und während man schon den Palasthügel hinauffuhr, fiel ihm ein, wie der siebenjährige Steve seine Ernennung aufgefasst hatte: „Du wirst Botschafter? O Daddy! Da reitest du auf einem Pferd und überbringst wichtige Briefe...“ Nun, im Prinzip hatte Steve schon recht gehabt.
Frank A. King stieg als erster aus, wie stets. Obwohl innerhalb der vier Meter hohen Palastumfriedung nichts mehr zu befürchten war, sah er sich rasch um; eine tief sitzende Gewohnheit. Der Schutz des Botschaftspersonals oblag ihm auch dann, wenn ganz andere dafür verantwortlich waren. Die Auffahrt glühte, flirrende Luft, grelle Reflexe – drei Jahre in diesem Land hatten ihn gegen die Hitze nicht unempfindlicher gemacht. Außerhalb klimatisierter Räume litt er wie am ersten Tag. Sein weißer Leinenanzug, frisch gestärkt, lag ihm wie eine Rüstung aus Sperrholz an. Er wünschte das Ende der Zeremonie herbei; dreißig Minuten sollte sie dauern. In Washington lag die Norm für Antrittsbesuche bei weniger als zehn Minuten. Dort trugen die Botschafter und auch der Präsident ihre Reden nicht vor, sondern tauschten nur die vorbereiteten Texte aus, was die Sache abkürzte. Hier aber hörte man sich gern reden.“
Erstmals 2003 hatte Holda Schiller beim Scheffler-Verlag Herdecke ihr Buch „Pechvogel Glückspilz“ herausgebracht: Drei märchenhafte Geschichten sind in dem E-Book vereint, die sowohl für Kinder als auch für erwachsene Märchenliebhaber ein reizvolles Lesevergnügen bieten. Die Geschichte „Pechvogel Glückspilz“ ist eine Art osteuropäische Version von „Hans im Glück“, sie könnte unter dem Motto stehen: Wo eine Tür sich schließt, tut sich eine andere auf - sei es von Menschen- oder Engelhand. Die Däumlingsgeschichte ist neu in dieser Art, wo Tim und Wim zu Däumlingen schrumpfen, dann aber durch Friedolins Zauberkraft und nach Erfüllen bestimmter Aufgaben wieder normale Größe erreichen. In „Stromerin Leila“ gerät Leila mit der Pflicht in Konflikt, sie reißt aus, geht ‚in die Welt' und kehrt nach allerlei Abenteuern wieder zurück. Die Geschichten von Holda Schiller sind spannende, schwungvolle, mit viel Fantasie und feinem Humor erzählte kleine Werke. Und so fängt die Geschichte von Tim und Wim und Zauberer Friedolin an. Aber ist er überhaupt ein Zauberer?
„In einer Stadt in Deutschland, das man rühmte, es habe die fleißigsten Bürger der Welt, lebten zwei Jungen, Tim und Wim, der eine gelb-, der andere schwarzhaarig, beide etwas über fünf Jahre alt, die sich oft schrecklich langweilten, denn weder die Eltern noch die Großmutter, die mit in der Familie lebte, hatten Zeit, sich ihnen zu widmen. Der Vater musste sich tagtäglich umfassend informieren, er war Journalist, die Mutter musste sich qualifizieren, sie war Sprachmittlerin, und die Großmutter war Lehrerin und hatte ständig etwas zu korrigieren. Alle drei hatten sie die Kinder wohl ein Jahr und länger nicht mehr richtig gesehen, da ihre Gedanken stets nur bei den Pflichten weilten, und sie sich selten die Zeit nahmen, auch einmal von der Arbeit aufzuschauen. Gern hätten die Kinder wenigstens eine Katze zum Spielen gehabt, doch die bekamen sie nicht, weil der Vater Tiere in der Wohnung auf den Tod nicht ausstehen konnte.
Eines Tages kam der Vater von einer Dienstreise zurück und rief Tim und Wim zu sich. Er strahlte vor Freude und Erfolgstolz, denn er brachte ihnen ein Spielzeug mit, das er auf dem Flohmarkt erstanden hatte. Es war eine lustige Figur, ein aus Pappe angefertigter Hampelmann, den der Vater als fröhlichen Tänzer vorstellte, der bunt bemalt war, mit farbigen Schnüren versehen und einen dunkelblauen Spitzhut trug, an dem goldene Sterne funkelten. Die großen Augen, das eine grün, das andere rot, sahen ein wenig verschwommen aus, so, als lägen sie hinter Tränenschleiern, was den Erwachsenen, vor allem aber den Kindern, sehr zu Herzen ging. Tim und Wim, obgleich sie erst ein wenig misstrauisch und zurückhaltend gewesen waren, gewannen den sonderbaren Tänzer sofort lieb und spielten gern mit ihm. Wenn sie an seinen Schnüren zogen, tanzte der Hampelmann überaus anmutig, und es leuchtete das grüne Auge wie Sterne leuchten und füllte die Stube mit grünlichem Schein, der Erwachsene und Kinder bezauberte. Er tanzte so gut und gefällig, dass alle glaubten, es könne sich kein Ballettstar in der Tanzkunst mit ihm messen, und dass es auf Erden Ähnliches nicht gebe.
Tim und Wim freuten sich erst einmal sehr. Sie gaben dem Hampelmann den Namen Friedolin, hängten ihn im Kinderzimmer an die Wand und ließen ihn von morgens bis abends tanzen. Mal zog der eine, dann der andere an den Schnüren, und der Hampelmann bewegte seine Glieder von Mal zu Mal immer noch leichter und anscheinend auch immer noch graziöser. Das gab den Kindern zunächst viel Spaß. Doch wie das so ist, es dauerte nicht lange, und sie kannten die Anmut seiner Bewegungen, die Kühnheit seiner Sprünge, jede Regung seines Gesichts, und sie verloren das Interesse an dem lustigen Spiel. Sie beachteten Friedolin immer weniger, bis sie ihn ganz vergaßen. Es half auch nicht, dass er Tim und Wim immer wieder zuflüsterte: Zieht doch an meinen Schnüren, ich tanze so gern! Manchmal fügte er hinzu: Tanzen ist mein Liebstes, aber zaubern kann ich auch.
Darüber lachten Tim und Wim, das glaubten sie Friedolin nicht. Als er sie dann wieder einmal daran erinnerte, dass er zaubern könne, spotteten sie: „Na, dann zaubere doch, du drolliger Prahlhans! Wir sind schon mächtig gespannt darauf. Am Ende hängt das Zimmer voller Pappnasen, wie du eine bist.“ Solche Reden betrübten Friedolin. Da aber die Kinder ihm am Anfang so sehr zugetan gewesen waren, blieb er ihnen gewogen, auch wenn sie sich nicht mehr um ihn kümmerten und ihm immer ungezogener begegneten. Er hing an der Wand und schien vor sich hinzudösen. Doch in Wahrheit war er wach. Es grämte ihn, dass die Kinder mit der Zeit zu missraten drohten, dass sie sich mehr und mehr als nichtsnutzig erwiesen, dass sie ihn hänselten oder gar versuchten, ihn zu beschädigen. Und das war nicht einmal seine größte Sorge. Es geschah nämlich etwas mit den Kindern, das weder sie selbst noch die Erwachsenen wahrnahmen: Tim und Wim wuchsen nicht wie andere Kinder und wurden größer mit dem Alter, sondern umgekehrt, sie schrumpften, sprossen nicht in die Höhe und wurden größer, sondern in die Tiefe und wurden kleiner. Das bedrückte Friedolin, denn er kannte die Ursachen und die Folgen dieser Art zu wachsen und dachte ständig darüber nach, sinnierte, wie er das Geschehen den Eltern verständlich machen sollte, damit sie der entsetzlichen Entwicklung Einhalt geböten.“
Schon 1960 brachte Heiner Rank unter dem Pseudonym Heiner Heindorf im damaligen Verlag Kultur und Fortschritt Berlin seine Kriminalerzählung aus dem Orient „Der grüne Stern“ heraus – als 2. Augustheft im 11. Jahrgang der Kleinen Jugendreihe: Achmed führt seine Karawane sicher auf Schleichwegen durch die ägyptische Wüste. Sie müssen sich vor den Streifen des ägyptischen Frontier-Corps hüten, einer Spezialtruppe zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels. Beinahe wären sie in der Wüste eingekreist worden, aber ihr Gewährsmann beim Frontier-Corps kann sie rechtzeitig warnen. Die Karawane verliert einige Männer und ein mit Rauschgift vollgepacktes Kamel, der Rest der Ladung kann abgeliefert werden. Doch ihr Gewährsmann liegt verwundet im Kairoer Militärkrankenhaus. Er ist rauschgiftsüchtig und wird sicher alles tun, um das benötigte Opium zu bekommen. Achmeds Hintermänner wollen auf keinen Fall ihren Gewährsmann verlieren. Sie ahnen nicht, dass Ihnen das Frontier-Corps schon dicht auf den Fersen sitzt. Eine spannende Jagd beginnt. Folgen wir Ahmed und seinen Leuten auf ihren gefährlichen Wegen durch die Wüste …
„1. Kapitel
Es ist Nacht. Kamele klettern in langer Reihe einen steinigen Pfad hinauf. Fast lautlos, wie große dunkle Schatten gleiten sie dahin, nur das leise Klirren des Zaumzeugs und das Knarren der ledernen Gepäckgurte dringt durch die Stille. An der Spitze der Karawane reitet Achmed. Etwa vierzigjährig ist er, groß und hager. Die schwarzen Augen im braunen Gesicht blicken kalt. Um den Mund spielt ein dünnes, verächtliches Lächeln. Am blauschwarzen Himmel glitzern unnatürlich hell die Sterne. Der Weg, der sich zwischen Felsbrocken hindurchwindet, liegt in tiefem Dunkel. Doch Achmed findet ihn mit Sicherheit. Er kennt das felsige Hochplateau zwischen dem Roten Meer und dem Niltal so genau wie die verwinkelten Gässchen seines Heimatdorfes. Und je dunkler die Nacht, um so lieber ist es ihm und seiner Truppe. Denn nicht zum ersten Mal sind sie auf diesen wenig bekannten Schleichwegen unterwegs, und oft schon hingen Leben, Erfolg und gute Belohnung nur von der tiefen Dunkelheit der Nacht, von Achmeds zuverlässiger Ortskenntnis und seinem hervorragenden Orientierungssinn ab. Scharfäugig mustert er die Felsen, deren schwarze Silhouette sich deutlich gegen den sternenübersäten Himmel abzeichnet. Seine Nasenflügel blähen sich — sogar den Geruch der Luft und der kümmerlichen, halbverdorrten Sträucher, die einigen weit verstreuten Schafherden karge Nahrung geben, scheint er zu prüfen und für die Bestimmung seines Standortes auszunutzen. Dann nickt er vor sich hin, und das verächtliche Lächeln wird für einen Augenblick selbstzufrieden .Er weiß jetzt, dass sie nur noch knappe fünfzig Kilometer von ihrem Reiseziel entfernt sind.
Am Golf von Akaba, an der Ostküste der Halbinsel Sinai, hat Achmed die Karawane übernommen und sie auf verschlungenen Wegen quer durch das felsige Hochland der Halbinsel zur Küste des Golfes von Suez geführt. Dort wurden sie bereits von Booten erwartet. In einer stürmischen Nacht wagten sie den Sprung von Asien nach Afrika. Die kleinen, wendigen Boote brauchten nur ein paar Stunden, den sechzig Kilometer breiten Golf zu überqueren. Doch erst dann, am Ufer des afrikanischen Festlandes, begann der schwierigste Teil des Unternehmens. Es galt, in höchster Eile die Spuren zu verwischen, welche die dreißig Männer und die neunzig Kamele bei der Landung im weichen Ufersand hinterlassen hatten. Bevor die berittene Streife des ägyptischen Frontierkorps (ägyptische Spezialtruppe zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels) in Sicht kam, mussten sie hinter der ersten Bergkette des Festlandes verschwunden sein. Aber selbst nach vielen Stunden, wenn das Wasser und der schneidende Küstenwind für ein gewöhnliches Auge die Spuren völlig eingeebnet haben, können die tüchtigen, aus Oberägypten stammenden Kamelreiter des Frontierkorps an einer kleinen Vertiefung, an der unnatürlichen Lage einer winzigen Muschel, an einem Stückchen Seetang, das von einem Kamelhuf über den Bereich der an den Strand rollenden Wogen hinausgetragen wurde, erkennen, dass hier eine Schmugglerkarawane gelandet ist.
Auch die Spuren von Achmeds Kamelen sind ihren geübten Blicken nicht entgangen. Sofort setzte ein gewaltiges, sich über Hunderte von Quadratkilometern erstreckendes Kesseltreiben gegen die Schmuggler ein. Aber Achmed konnte seinen Verfolgern ein Schnippchen nach dem anderen schlagen und schüttelte sie schließlich ab. In der glühenden Hitze des Tages pflegte die Karawane, gut versteckt vor möglicherweise auftauchenden Suchflugzeugen, zu rasten. Erst in den kühlen Abendstunden ergänzte sie aus geheim gehaltenen Brunnen ihren Wasservorrat und zog dann bei Nacht weiter! Zweihundert Kilometer hatte sie auf diese Weise von der Küste aus zurückgelegt.“
Drei Jahrzehnte und einen gesellschaftlichen Wandel in seinem Heimatland später veröffentlichte Erik Neutsch erstmals im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale) sein nach wie vor aktuelles und mutiges Buch „Claus und Claudia. Nach neueren Dokumenten“: Claus Salzbach, Diplomat der DDR im auswärtigen Dienst, erhält in Paris die erschütternde Nachricht, dass seine Tochter Claudia eine tiefe Nervenkrise durchlebt. Sofort kehrt er in die Heimat zurück, doch womit er dann hier konfrontiert wird, erscheint ihm zunächst unglaubhaft: An der medizinischen Fachschule, an der Claudia studiert, werden Erziehungsmethoden praktiziert, die von erstarrtem Denken und Herzlosigkeit der Lehrkräfte zeugen, bis zu Verdächtigungen und Drangsalierungen gegenüber den Schülerinnen reichen und gegen die seine Tochter sich vergebens gewehrt hat. Salzbach, wie weiland Michael Kohlhaas, beginnt um die Gerechtigkeit in der Beurteilung junger Menschen zu kämpfen, doch auch er stößt auf Anmaßung, Opportunismus, gar Feigheit. Als er schließlich Verbündete findet und die unhaltbaren Zustände an der Fachschule untersucht werden - welche Chancen hat da noch Claudia, ihre Krise zu überwinden? Wie schon vorher in seinen literarischen Arbeiten zielt Erik Neutsch mutig und kritisch auf wesentliche moralische Fragen der DDR-Gesellschaft, wobei er den Leser auffordert, darüber mitzubefinden. Wir treffen Claudia und ihren Vater während ihrer ersten Begegnung nach langer Zeit und nach einem erschütternden Ereignis. Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
„2. Kapitel
Er ging mit Claudia durch den Park. Der Altweibersommer spann seine Fäden, und hier und dort färbte sich das Laub der hohen Birken und Buchen bereits gelb, rot und samtig braun. Auf dem See schwammen schwarze Schwäne. Claudia aber, merkte er, wandelte im Augenblick neben ihm her wie geistesabwesend. Sie gewahrte das alles nicht, das Feuer im Blattwerk von Bäumen und Büschen, die Schwäne, auch den strahlend blauen Himmel nicht. Sie klammerte sich an seinen Arm und wiederholte des öfteren, mit zittriger und doch tonloser Stimme, die Sätze: „Ach, Vati, Vati, weißt du... Wie gut, daß du gekommen bist. Sie wollen mich fertigmachen ...“
So hatte er sie nicht in Erinnerung, sie, wie er stets geglaubt hatte, mit der fröhlichen, unbefangenen Art, sich dem Leben zu stellen, vergleichbar in dieser Hinsicht, diesem Charakterzug nur noch mit ihrer Mutter. Martina, dachte er mit einem Mal, das Bild seiner Frau vor Augen, als er seine Tochter prüfend von der Seite betrachtete, warum mußtest du von mir gehen, mich allein lassen, jetzt, wo ich deine Hilfe vielleicht am meisten gebrauchen könnte.
Sie war hübsch. Das hatte er jedesmal mit einem gewissen väterlichen Stolz konstatiert, wenn er Claudia ins Gesicht sah. Ihr dichtes und dunkles Haar fiel bis auf die Schultern. Ihre schön geschnittenen Züge in dem Oval, die Lippen, die Stirn, die klaren Augen - auch das erinnerte ihn an Martina. Doch sobald sie ihn jetzt anschaute, sprach aus ihrem Blick, ihren graugrün umrahmten Pupillen längst nicht mehr jene unschuldsvolle, fast schon naive Offenheit von einst, sondern eher eine tiefe, verzweifelte Traurigkeit.
Was bloß konnte er dagegen tun? Nein, sie war es nicht mehr. Claudia, das Ebenbild ihrer Mutter. Blaß wirkte sie jetzt, ihre Schlankheit zerbrechlich. Es überkam ihn, sie fest in die Arme zu nehmen, an seine Brust zu pressen und sie seine Wärme spüren zu lassen – wie früher als Kind. Am schwersten wohl fiel ihm, sich damit abfinden zu müssen, daß sie nun selbst eine Frau war mit ihren zweiundzwanzig Jahren und einem bitteren Leben schon hinter sich.
Nervenzusammenbruch - so lautete die Diagnose. Deshalb war sie in die Klinik für Neurologie der Universität in W. eingeliefert worden. Claus Salzbach hatte vor einer Stunde erst mit dem Arzt gesprochen, der sie behandelte. „Wie gut, daß Sie sich haben frei machen können ...“ Worte, wie er sie ähnlich nun auch von Claudia hörte. „Ihre Tochter ist ein sehr bewußt lebender Mensch. Um so rätselhafter erscheint es mir, warum sie zu den Tabletten griff. Nein, nein, nur ein angedrohter Suizid war es nicht, eher freilich ein Versuch im Affekt. Als künftige Hebamme aber wußte sie um die Folgen. Danken Sie daher Gott oder wem sonst, daß ihre Großeltern sofort die Schnelle medizinische Hilfe alarmierten. Wir pumpten ihr den Magen aus. Aber damit ist ja nicht ihr Konflikt, den sie unbestreitbar mit sich herumschleppt, aus dem Blut. Herr Salzbach ... Wenn ich Sie bitten darf ... Nach Ihrem Spaziergang im Park. Melden Sie sich noch einmal bei mir. Vielleicht erhalten wir dadurch tiefere Aufschlüsse. Prüfungsangst? Die Enttäuschung, in zwei Fächern letztens nur mit einer Vier bestanden zu haben? Das allein kann es doch wohl nicht sein. Nicht bei einer solch intelligenten jungen Frau ...“
Fast auf den Tag genau zwölf Monate hatte er sie nicht mehr gesehen. Denn nur einmal im Jahr wurde ihm Urlaub gewährt, den er dann stets dazu nutzte, nach Haus zu reisen, in die Republik. In Vietnam und Ägypten hatten sie Claudia noch ständig bei sich gehabt. Sobald jedoch die Kinder von Diplomaten das vierzehnte Lebensjahr erreicht hatten, so wollten es die unerbittlichen Vorschriften, war es ihnen für gewisse Länder nicht mehr gestattet, ihre Eltern dorthin zu begleiten. Claudia hatte eine Internatsschule besucht, in der sie aber unter der Trennung von Mutter und Vater so sehr litt, daß sie in ihr nicht leben konnte. Martinas Eltern nahmen sich ihrer an. Sie zog zu ihnen, und auch jetzt, nach ihrer Scheidung und trotz eigener Wohnung, quartierte sie sich oft bei ihnen ein, zumal sie fortan ihren Sohn betreuten, um ihr das Praktikum mit dem unregelmäßigen Schichtdienst zu erleichtern. Vor fünf Jahren zum letzten Mal hatten er und seine Frau wenigstens noch mit ihr, da sie erst siebzehn war, somit nicht volljährig, den Urlaub gemeinsam in Frankreich verbringen dürfen. Er entsann sich deutlich. In Honfleur am Kanal, in dem kleinen Restaurant in der unmittelbaren Nähe der uralten Holzkirche, beim Essen der Fruits de la mer und beim Wein, da hatte sie ihnen gestanden, daß sie verliebt sei und bald heiraten möchte.
„Sie wollen mich fertigmachen ...“, sagte sie jetzt. Mit dieser Behauptung verband sie zugleich unglaubliche Geschichten, Erlebnisse jedenfalls, die Claus nicht für möglich hielt, zumindest für übertrieben ihrerseits. Frau Baumholder, erzählte sie, die Leiterin der Abteilung Hebammenausbildung an der Medizinischen Fachschule, die der Universität in W. angeschlossen ist, Parteimitglied obendrein wie sie, habe es besonders auf sie abgesehen, betrachte jede Regung, jede Äußerung von ihr wie unter der Lupe und scheine nur auf einen Fehler von ihr zu warten. „Vati, ich hab Angst vor ihr. Nachts schrecke ich aus dem Schlaf, weil sie mich bis in meine Träume verfolgt.“
Ob es Claus Salzbach, dem Diplomaten in schwieriger persönlicher Mission, seine Tochter zu retten und die Hintergründe ihrer Vorwürfe aufzuklären? Angeblich soll es im Chinesischen das gleiche Zeichen für die Begriffe Krise und Chance geben. Und Tochter Claudia befindet sich in einer tiefen Krise, als ihr Vater sie in der Klinik besucht. Aber ist diese Krise für sie auch wirklich eine Chance?
Auch wenn Claus Salzbach, nach Auskunft des Autors nach allem selbst nicht mehr bereit gewesen sei, Auskunft zu geben, so habe doch ein Bündel von zahlreichen Dokumenten, Aktennotizen und Protokollen genügend Einblick gewährt, um die Geschichte zu rekonstruieren. Eine außerordentlich lesenswerte Rekonstruktion – über einen Mann, mit dem eines Tages der heilige Zorn durchging „…und zwar von solcher Gewalt, daß er mit einem Schlag alle ihm auferlegten Konventionen mißachtete und zum Selbsthelfer wurde. Unerklärlich blieb lange, warum es ausgerechnet ihn, die Bedächtigkeit in Person, zu einem solchen Ausbruch der Gefühle hatte treiben können, und so soll auch hier nach den Gründen gefragt werden, wie es dazu kam.“ Es wäre sehr schade, ließe man sich die Chance entgehen, die Antworten auf diese Frage zu erfahren.