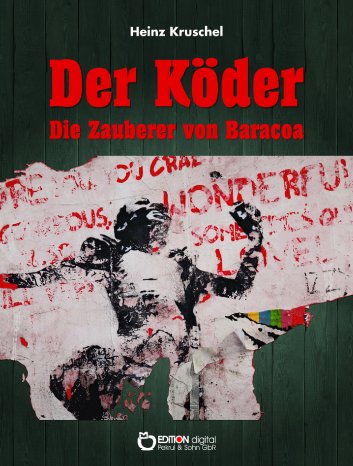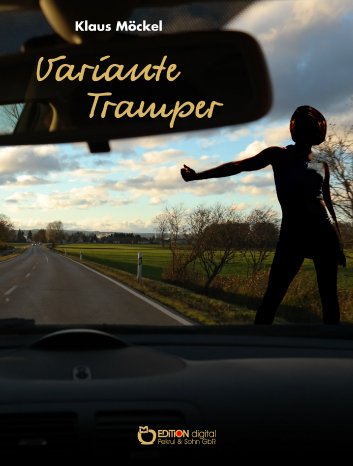In „Ausschreibung für einen Mord“ von Jan Eik kommt es Anfang der neunziger Jahre auf einer Großbaustelle im Berliner Regierungsviertel zu Unruhe und zu einer ebenso überraschenden wie unliebsamen Arbeitsunterbrechung. In einem Betonloch wird eine Jacke gefunden, aber nicht nur das …
In „Variante Tramper“ von Klaus Möckel ermittelt wieder die Kriminalpolizei der DDR – diesmal in der Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein kleines Mädchen ist überfahren und getötet worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Und die Kriminalisten sollen auf eine falsche Fährte gelockt werden.
Auf ganz anderes Terrain führen die beiden anderen Angebote dieses Newsletters: „Weg in den Herbst“ nannte der Lyriker, Essayist und Erzähler sowie DDR-Kulturfunktionär Uwe Berger seine 1987 erschienene Autobiografie.
„Der Köder. Die Zauberer von Baracoa“ heißt ein Band mit vier Erzählungen von Heinz Kruschel, in denen Jugendliche in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten vor fast unlösbare Aufgaben gestellt werden.
Zunächst aber wollen wir uns die drei Krimis anschauen – zumindest ein bisschen.
Erstmals 1987 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig der Kriminalroman „Gift für den Herrn Chefarzt“ von Dietmar Beetz: Gesundheitswesen und Marktwirtschaft - wie verträgt sich das? Und wie sah es im Umfeld weißer Kittel aus - hinter der Mauer? Wie wurde dort kuriert und geforscht, wie intrigiert und wie - Pardon! - poussiert? Dietmar Beetz, Hautarzt und Buchautor, gibt Antwort auf diese Fragen - genauer: legt einen Roman dazu vor. Sein Krimi ist nicht nur spannend und milieustark, er ist - zumal angesichts der Hiobsbotschaften zum Gesundheitswesen von heute - auch hochaktuell. Nach einem hier nicht nachzulesenden Prolog beginnt die Handlung des Buches mit einem nächtlichen Anruf:
„ERSTES KAPITEL“
1
Der Anruf kam gegen 23 Uhr 15. „Ein Fall für die K“ - so der Mann in der Vermittlung. Dann knackte es im Hörer, und bei den nächsten Worten, die Leutnant Hauboldt erfasste, wurde ihm klar, dass nun an Schlaf nicht mehr zu denken war.
„Moment“, rief er, „Moment! Wenn's geht, bitte der Reihe nach! Wer ist ermordet worden, wie hieß der...?“
„Grotsche, Doktor Grotsche, Chef der Hautklinik.“
Hauboldt notierte den Namen und ließ sich auch den Namen des Mannes, der auf ihn einsprach, buchstabieren. „Ebenfalls Doktor?“. erkundigte er sich.
„Ja. Das heißt - nein.“ Zum ersten Mal stockte Beyer.
„Wie denn nun?“
„Ich bin... Dipl.-Med. bin ich, Diplom-Mediziner; ich habe gerade, als es passiert ist, an meiner Doktorarbeit geschrieben. Im Zimmer für den Arzt vom Dienst.“
„Verstehe. Und als Arzt vom Dienst haben Sie den Tod festgestellt?“
„So ist es.“
„Um welche Todesursache handelt es sich Ihrer Meinung nach?“
„Um Vergiftung. Wahrscheinlich Zyankali.“
„Und berührt, am Tatort verändert...?“
„Ich werde mich hüten!“
„Gut, Herr Beyer. Wir kommen. Bis gleich!“ Hauboldt blieb noch einen Augenblick auf dem Rand der Liege hocken. Er hatte die Jacke über die Stuhllehne geworfen, den Gürtel gelockert und nur die Sandalen und die Socken ausgezogen. Trotzdem war er sofort in tiefen Schlaf gefallen. Mist, dachte er jetzt. Nun werden sogar die Ärzte umgebracht, die Helfer der Menschheit! Falls es überhaupt ein Mord war und dieser Diplom-Mediziner nicht bloß blinden Alarm ausgelöst hat. Wenn ich plötzlich vor der Leiche von Schmidt stehen würde... Die Vorstellung hatte etwas Befremdendes. Hauboldt stockte. - Wie kam er auf so eine Idee? Er rief die Vermittlung an und ließ sich mit der Wohnung von Oberleutnant Schmidt verbinden. Dabei wurde ihm bewusst, dass er drauf und dran war, sich in Beyer hineinzuversetzen. Die Sache hatte ihn also bereits gepackt.
„Tut mir leid“, sagte er zu Schmidt, „aber auch heute wird's nichts mit der Nachtruhe. Ein Mord, wie's scheint. In der Hautklinik hat man den Chef umgebracht, einen Doktor Grotsche, vermutlich mit Zyankali.“
„Grotsche?“, fragte Schmidt, und Hauboldt meinte zu sehen, wie sich die Stirn seines Vorgesetzten in Falten legte. „Doktor Grotsche? War der Chef der Hautklinik nicht ein gewisser Vogelsang? Oder Vogelfang?“
Hauboldt empfand sein altbekanntes Unbehagen. „Keine Ahnung“, sagte er. Ihm war, als sei ihm eine Wissenslücke nachgewiesen worden.
„Na, ist ja auch egal“, erwiderte der Oberleutnant. „Jedenfalls war's ein ulkiger Name, einer, der zu dem Alten gepasst hat. Und der Nachfolger, sagst du, wurde ermordet?“
„Nicht ich sag das. Der Arzt vom Dienst, der mich informiert hat, ein Arzt der Klinik, wo es passiert ist - der war der Meinung, es sei Mord; und ob es sich um den Nachfolger handelt...“
„He, he! Du hast wohl schlecht geschlafen? Wann holst du mich ab?“
„Bin schon unterwegs.“
2
Die Hautklinik lag am Rande der Stadt. Kam man vom Zentrum her, fiel der Blick plötzlich auf ein markantes, die Umgebung überragendes Gebäude: zwei Flügel und ein Mitteltrakt mit gedrungenem, turmförmigem Aufsatz. Dazu die Erker auf den Satteldächern, deren Schindeln matt im Mondschein glänzten...
„Früher hieß der Bau 'die Tripperburg´“, sagte Schmidt. „Anfang der fünfziger Jahre, als ich so alt war wie du und noch mit Streife gegangen bin, hatten wir hier oben beinah jede Woche zu tun. Zeiten waren das damals!“
Hauboldt, am Lenkrad des Dienstwagens, knurrte. Immer dasselbe, dachte er. Als sei es meine Schuld, dass wir jetzt zweiundsiebzig schreiben und ich nicht mit Streife geh wie er in seinen goldenen fünfziger Jahren. Er bog ab von der Straße und steuerte den Wagen, von Schmidt dirigiert, um den rechten Seitenflügel herum.
„Hier haben wir auch damals immer geparkt“, sagte der Oberleutnant. „Und dort unterm Dach - dort war die geschlossene Station, der 'Himmel' für die 'Engelchen', die Mädchen mit ha-we-Ge, die sich der Kontrolle entzogen hatten und von uns hinterm Bahnhof oder in ihren Stammkneipen...“
„Ich weiß“, fiel ihm Hauboldt ins Wort. „Ich kenne das alles von der Ausbildung her.“
Schmidt erwiderte nichts und lächelte nachsichtig.
Sie gingen die Zufahrt zurück, schritten über Splitt und dann auf Steinplatten zum Haupteingang. Im ersten Stock des linken Flügels waren mehrere Fenster erhellt. Die übrige Fassade stand schwarz im Mondschatten. Jetzt mit Ulla in der Mansarde liegen! dachte Hauboldt. Oder, wennschon, über Land gehn. In so einer Nacht einen Menschen umzubringen!
Auch Schmidt, der Oberleutnant, war nachdenklich geworden. Sein Gesicht, rund und hell wie der Mond, wirkte einfältig. Beschäftigten ihn noch immer Erinnerungen, Abschweifungen, von denen er behauptete, sie gehörten dazu; einen Fall gehe man am besten vom Umfeld her an?
Steinstufen, auf denen die Schritte hallten; eine mehrteilige, verschlossene Haustür... Schmidt drückte auf einen Klingelknopf. Eine Weile war nur Motorengeräusch zu hören, ein einzelnes Auto auf der nahen Straße. Hauboldt, ungeduldig geworden, wollte ein zweites Mal klingeln, als drinnen Licht anging. Durch das Glas der Tür sah er, wie eine Krankenschwester herkam, um aufzuschließen. Die Umrisse ihrer Gestalt mit dem Häubchen und dem kurzen Kittel erschienen ihm viel versprechend. Was er dann aus der Nähe sah, war mehr als eine Bestätigung. Beeindruckt musterte er das Mädchen, das die Tür hinter ihnen zuzog und dabei ohne Unterbrechung redete. Schneewittchen, dachte er, aber ein Schneewittchen mit Drum und Dran, und davon nicht zu knapp. Die Kriminalisten hatten ihre Ausweise gezeigt und ihre Namen genannt; die Schwester schien es überhaupt nicht bemerkt zu haben. Gut, dass sie kämen, sagte sie, als könnten nur sie und sonst niemand Einlass erbitten, und nun erzählte sie bereits zum zweiten Mal, wie schrecklich es gewesen sei: der Chef - ganz blau im Gesicht, und die Krämpfe!
„Da haben Sie ihn also sterben gesehn?“, fragte Schmidt, während er sich im Vorraum umsah.
Die Schwester nickte, beflissen wie ein Schulmädchen. Hauboldt fiel auf, dass ihre Lippen zuckten. Sie war von einem Augenblick zum anderen verstummt.
Schmidt richtete seine Aufmerksamkeit auf die Pförtnerloge, die sich rechts neben einem Fenster befand, und erkundigte sich: „War er ihr erster Toter?“ Er klopfte dabei an die dunkle, spiegelnde Scheibe.
Die Schwester schwieg verwirrt. Hilfe suchend schaute sie zu Hauboldt. Der verdeutlichte ihr die Frage des Oberleutnants, wobei ihm ein Grinsen unterlief.
„Nein, nicht der erste“, antwortete sie. „Als Krankenschwester ist man ja öfter dabei, wenn jemand stirbt, schon während der Ausbildung. Aber er war doch der Chef, und ich – ich hatte ihm den Tee gebracht.“
„Den Tee mit dem Gift?“
„Ja. Das heißt, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht erklären, wie es passiert ist, und auch die anderen, Beyer und der Oberarzt - wir alle stehen vor einem Rätsel.“
Inzwischen war Schmidt an einer Flügeltür mit Glasfüllung angelangt. Dahinter zeichnete sich im Licht einer Deckenbeleuchtung verschwommen eine Halle ab. Schmidt hielt der Schwester die Tür auf und sagte in seinem verbindlichsten Ton: „Um das Rätsel zu lösen, deshalb sind wir ja hier.“
Hauboldt folgte in die matt erhellte Halle. Links las er auf einem Schild: POLIKLINISCHE ABTEILUNG, rechts bemerkte er einen Korridor, der sich im Dunkeln verlor; LABOR und TESTABTEILUNG war neben dem Eingang zu lesen. Türen im Dämmer, Winkel und Nischen mit Türen; Türen und Pforten, wohin man sah. Ein unübersichtliches Haus, sagte sich Hauboldt, und auf der Treppe, im Blick ein Paar gebräunter, flaumig behaarter Beine, dachte er: Da herrscht mehr Übersicht, alles, was recht ist.
Im ersten Stock, vor der Tür zur Station Männer I, blieb Schmidt stehen und wies zu einem Bild an der Wand.
„Der Professor“, sagte die Schwester. „Professor Vogelsang, unser ehemaliger Chef.“
„Hast du gehört?“, wandte sich Schmidt triumphierend an Hauboldt. Das Porträt zeigte einen Mann mit hoher Stirn und großen Augen. Die Augen waren das Bestimmende. Ernst und mit einiger Trauer, schien es, schauten sie den Betrachter an.
„Von Ulk keine Spur“, sagte Hauboldt zu Schmidt.
„Und doch war er ein lustiger Mann“, beharrte der Oberleutnant. „Lebt er eigentlich noch?“, erkundigte er sich bei der Schwester.
„Er ist vor zwei Jahren gestorben. Leider. Das Herz...“
„Und Doktor Grotsche war sein Nachfolger?“
„Nicht direkt.“ Die Schwester, die Hand schon auf der Klinke, senkte die Stimme. „Bis Januar hatten wir Doktor Marburgk, den Ersten Oberarzt, als kommissarischen Chef. Er ist drin; Beyer hat ihn gleich angerufen.“
Die beiden Ärzte kamen den Kriminalisten entgegen. Der eine, jüngere, trug einen weißen Kittel, der andere einen grauen Anzug. Auch sein schütteres Haar und selbst sein Gesicht waren grau.
„Marburgk“, sagte er und gab Schmidt und Hauboldt, die sich gleichfalls vorstellten, die Hand. Sie war trocken und weich, anders als die feste, zupackende, schweißfeuchte Hand von Beyer.
„Kommen Sie bitte!“ Der Oberarzt ging voran - ein Hausherr, der mit Würde und Selbstverständlichkeit führt. Vor einer Tür in der Mitte des Korridors, die sich in nichts unterschied von den anderen Türen dieser Krankenstation, blieb er stehen. „Bitte!“
Hauboldt ließ Schmidt den Vortritt. Von der Schwelle aus umfasste er mit dem Blick Bücher und Mappen in einer Schrankwand, ein Buch und ein Tablett mit Geschirr auf einem Schreibtisch, ein Tischchen und zwei Sessel in einer Ecke...
Dem Toten auf der Liege wandte er sich, wie vor ihm der Oberleutnant, zuletzt zu. Mittelgroße Gestalt um die Vierzig, glattes, fahlblondes Haar, hageres Gesicht mit entspannten, dennoch harten Zügen... Ein Dutzendtyp, vielleicht nicht unansehnlich, dachte Hauboldt, froh, zu diesem Chefarzt keinen Steckbrief verfassen zu müssen.
Inzwischen hatte sich Schmidt an den Schreibtisch herangepirscht. Das Geschirr auf dem Tablett ließ er unbeachtet; die Hände auf dem Rücken, beugte er sich über das Buch, das daneben aufgeschlagen lag - quer auf den Seiten ein Schullineal und drei Farbstifte.
„`Handbuch der Hautkrankheiten', Band zwei“, sagte Dr. Marburgk, der Oberarzt, von der Tür her. „Erweitertes Facharztwissen“, fügte er im selben nüchternen Tonfall hinzu.
Schmidt schaute auf. „Haben Sie nachgesehen, darin geblättert?“
Marburgk lächelte. „Nicht nötig. So was erkennt man im Vorbeigehn oder von hier aus.“
Schmidt nickte und schnupperte kurz an der Tasse - das Zeichen für Beyer, der neben dem Oberarzt stand und jede Bewegung der Kriminalisten misstrauisch verfolgte. „Zyankali!“, stieß er hervor.
Einen leichten Geruch nach bitteren Mandeln hatte Hauboldt bereits beim Eintreten bemerkt. Auch die hellroten Flecken am Hals des Toten waren ihm nicht entgangen, und hatte die Schwester nicht von Krämpfen geredet? - Alles Zeichen einer Zyankalivergiftung, und doch ließ Schmidt sich mit einer Erwiderung Zeit. Er stand jetzt hinter dem Schreibtisch, breit und gedrungen, musterte die Schwester und die beiden Ärzte, musterte sie und schwieg. Die drei, ohnehin voller Erwartung, schienen zu erstarren, und selbst Hauboldt, der die Taktik des Oberleutnants kannte, wartete mit zunehmender Spannung auf das nächste Wort.
„Zyankali...“ Es kam ganz beiläufig heraus. „Man wird's bestätigen. Wie aber“ - die Stimme stieß zu -, „wie kommt Zyankali in seinen Tee?“
Diesmal wollte die Rechnung nicht aufgehen. Oder doch? Die drei an der Tür, nach den ersten Worten entspannt, hielten die Luft an, und nun blieb der Oberleutnant am Ball.
„Ihre Meinung, Doktor Marburgk: Liegt Suizid vor?“ Der Graugesichtige wiegte den Kopf. „Wohl kaum.“
„Also Mord“, schloss Schmidt. „Und woher das Gift, Herr Doktor?“
„Woher soll ich das wissen?“
„Und Sie, Herr Beyer?“
„Ich?“ Der Diplom-Mediziner warf einen Blick zu der Schwester. „Sie tun ja gerade, als wären wir..., als käm jemand von uns in Frage!“
„Was natürlich kompletter Blödsinn ist, nicht wahr, Schwester Ramona?“
Sie riss die Augen auf, holte tief Luft, brachte aber kein Wort heraus. In der Stille, die eintrat, meinte Hauboldt Geräusche zu hören. Er sah, wie Schmidt zu einer Attacke ansetzte, machte ihm ein Zeichen, bedeutete der Schwester und den Ärzten, ihn vorbeizulassen, stieß die angelehnte Tür auf.
„Schön“, hatte der Oberleutnant zögernd begonnen. „Sie schweigen also, obwohl...“ Er brach ab. Auf dem Korridor wurden Schritte laut, und Gemurmel drang her. Hauboldt stand noch immer in der Tür, blickte nach rechts, nach links. Was ging hier vor?“
Unter dem Titel „Ausschreibung für einen Mord“ erschien der Architektenkrimi von Jan Eik 1998 bei avedition Stuttgart und 2002 unter dem Titel „Auf Mord gebaut“ 2002 bei berlin. Krimi: In dem Fundament eines Berliner Regierungsbaus wird die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Als bei dem verantwortlichen Architektenbüro wenige Tage später eingebrochen wird, wittert der Seniorchef eine Intrige und bittet Oliver John, seines Zeichens Privatdetektiv und ein Liebhaber feiner Lebensart, um Hilfe. Er soll sich undercover in die renommierte Firma einschleusen und herausfinden, wer da ein mörderisches Spiel treibt und warum. Der Auftrag führt OJ in eine bunte Architektengruppe, in der anscheinend jeder etwas gegen jeden hat. Und plötzlich geschieht ein weiterer Mord ... Zuerst aber sind wir auf einer Berliner Baustelle:
„1. Kapitel
Von der künftigen Schönheit des Gebäudes mitten im Berliner Regierungsviertel war wenig zu erkennen. Aus der Decke der oberen Kelleretage erhoben sich Bewehrung und Schalung für das repräsentative Erdgeschoss. Alle zwölf Minuten rollte ein neuer Transporter mit neun Kubikmeter Beton heran und pumpte die Ladung zwischen die Schaltafeln. Fünfundvierzig Kubikmeter in einer Stunde an jeweils zwei Stellen der massiven Außen- und der Zwischenwände, die das ausladende Foyer von den beiden Gebäudeflügeln trennen würden.
Die Betonierung hatte am Morgen nicht rechtzeitig begonnen, weil der gefürchtete Prüfingenieur Adlé bei seiner Begutachtung der Stahlbetonbewehrung nicht gerade großzügig verfuhr und tausenderlei zu bemäkeln hatte. Möglicherweise wäre man am Abend dennoch planmäßig fertig geworden, hätte es am frühen Nachmittag nicht plötzlich eine unerklärliche Stockung beim Beton gegeben und wäre nicht zu genau diesem Zeitpunkt die Polizei samt Gewerbeaufsichtsamt, Arbeitsamt und einem halben Dutzend weiterer Behörden auf der Baustelle aufgetaucht, um nach Schwarzarbeitern zu fahnden.
Meisner, der verantwortliche Bauingenieur, fluchte in sich hinein und war doch insgeheim froh, dass weit über die Hälfte seiner Arbeitskräfte sich im Augenblick gerade an den umliegenden Imbiss- und Pommesbuden mit einer zusätzlichen Stärkung auf den langen Abend vorbereitete. Die meisten waren immerhin so pfiffig, die Gefährlichkeit der gezielten Aktion zu erkennen. Im Verlauf der nächsten halben Stunde kehrten nur die zurück, deren Papiere in Ordnung schienen, und das waren wenig genug.
Das kam davon, wenn man sich auf das alles überwuchernde Subunternehmertum einließ, auf windige Geschäftemacher, die einem den Abhub an billigsten Arbeitskräften aus halb Europa, Nordafrika und Vorderasien auf die Baustelle kehrten. Alles angebliche Baufacharbeiter, von denen manche nicht wussten, wozu der Zement im Beton nötig war oder wie man sich eines Zollstocks bediente. Meisner sah den Tag kommen, an dem ein philippinischer Polier mit einer lendenschurzbekleideten malayisch-turkestanischen Crew an Bambusstangen auf dem Bau herumturnen würde. Er selber hatte nicht das Geringste gegen Ausländer, solange sie Lokale betrieben, ihm gelegentlich geschmuggelte Zigaretten verkauften oder ihn im Urlaub so freundlich empfingen, wie er es glaubte verdient zu haben. Auf der Baustelle hatten sie für seine Begriffe nichts verloren. Jedenfalls war es spät geworden. Sehr spät sogar.
Zum Glück waren bei der Razzia nur drei Ausländer ohne gültige Papiere angetroffen worden; die meisten der Männer hatten sich im Lauf des Nachmittags wieder auf der Baustelle eingefunden. Nachdem die tägliche Rushhour in den normalen Abendverkehr übergegangen war, fuhren die Trudelbecher mit dem Transportbeton pünktlich vor und stauten sich mitunter für ein paar Minuten.
Meisner wusste nicht, wo ihm der Kopf stand. Er war seit vier Uhr morgens auf den Beinen, und es sah nicht so aus, als würden sie vor vier Uhr früh fertig sein. Blieben ihm zwei, maximal drei Stunden Schlaf im Auto, wie schon öfter, wenn es für die Fahrt zu seinem eigenen Heim weit draußen im westlichen Berliner Umland zu spät, vielmehr zu früh wurde.
Glücklicherweise gab es ja Funktelefone, sodass seine Frau sich nicht sorgen musste. Ansonsten hasste Meisner Handys, die es aufgeblasenen Bauherrn, selbstgefälligen Architekten oder wer immer glaubte, ihm Vorschriften machen zu müssen, erlaubten, ihn zu jeder beliebigen Tages- und Nachtstunde zu belästigen. Meisner hatte inzwischen Bauscheinwerfer heranschaffen lassen, denn trotz Sommerzeit und hohem Sonnenstand war allmählich die Dämmerung auf die Baustelle herabgesunken. Sorgenvoll blickte er hinüber zu den Betontransportern. Gerade reihte sich der Dritte in die Schlange ein, die sich gebildet hatte. Es fehlten einfach genügend Leute, um ein Sockelgeschoss von derartigen Ausmaßen in einer Schicht zu gießen. Aber das den Leuten von P & H klarzumachen, insbesondere der arroganten Architektin mit dem Doppelnamen, die vom Bau so viel verstand wie ein Gewerkschaftsboss vom Mindestlohn, hatte er längst aufgegeben. Von ihr stammte der preisgekrönte Entwurf für den Bau der hauptstädtischen Bundesverwaltung, und dementsprechend gebärdete sich die Dame.
Mit dem alten Planckh, dem Seniorchef des renommierten Berliner Architekturbüros Planckh & Heppener, einem Mann in Meisners Alter und mit ähnlicher Lebenserfahrung, war am leichtesten auszukommen. Auch mit Gerald Heppener, einem fähigen Architekten, der bekannt war für seine unkonventionellen gestalterischen und bautechnischen Lösungen, gab es gewöhnlich kaum Schwierigkeiten. Weshalb die beiden sich ausgerechnet auf eine Mareike Lässig-Domagalla und ihr nicht gerade umwerfendes Projekt eingelassen hatten, stand auf einem anderen Blatt. Die glatte Fassade des zurückgesetzten Haupttraktes erinnerte Meisner an die in Berlin üblich gewordene Schuhkarton-Architektur - fehlten nur noch die spitzen Ecken. Da halfen auch die Säulen im Eingangsbereich nicht. Und die Seitenflügel wirkten kaum attraktiver. Hauptsache, den Hausherren aus Bonn gefiel der Bunker mit der geschliffenen Betonfassade.
Die Architektin hingegen war zweifellos eine sehr attraktive Dame aus dem Süddeutschen, und wahrscheinlich waren es ihre augenfällige Erscheinung und ihr davon bestimmtes Auftreten, die jedem Mann den Widerspruch gegen sie erschwerten, ja beinahe unmöglich machten. Es sei denn, man versuchte, sich in frotzelnd-kameradschaftlichem Ton mit ihr zu messen, was sie duldete, solange sie sich überlegen fühlte oder das Ganze als harmlose Anbaggerei abzutun bereit war. Dafür hatte sie etwas übrig. Allerdings nicht von einem kaum mittelgroßen alten Zausel wie Meisner, den seine Ehre als Bauingenieur und Mann der Praxis dazu zwang, ihr gelegentlich die Grenzen ihres bautechnischen Wissensstandes nachzuweisen. Also hatte es Meisner am Nachmittag unterlassen, P & H über die aufgetretenen Schwierigkeiten zu informieren. Das brachte ohnehin nichts. Er war hier der verantwortliche Bauleiter, niemand sonst. Und bis zum Morgen hatte der Sockel zu stehen. Basta.
Auf der Rüstung hinter dem Pfeiler rechts von dem für Meisners Geschmack ein wenig pompös geratenen Eingang war sein Sorgenkind Rocky dabei, zusammen mit einem jungen russischen Bauarbeiter den Rüssel der Mastpumpe in die Schalung zu hängen, als der Russe aufgeregt mit dem Arm zu winken begann und Rocky mit Stentorstimme „Halt, ihr Idioten!“ schrie, um im nächsten Atemzug auf seinen Kumpel
einzublöken: „Nurejew, du blöder Hund! Was hast du da reingeschmissen?“
Der unverdientermaßen mit dem berühmten Solisten Verglichene, der in Wahrheit weder Russe noch Tänzer war, antwortete nicht, sondern ließ sich an den Bewehrungsstählen vorsichtig auf das Niveau der Betonsohle hinab und griff in die schon erstarrende Schlempe, in der etwas Dunkles aufschwamm, das da auf keinen Fall hineingehörte.
Meisner, sensibilisiert für Katastrophen, bemerkte sofort, dass am Pfeiler etwas vorging, das ihn weitere Minuten kosten konnte, rannte über eine Bohle durch eine der Wandöffnungen und kletterte auf die fahrbare Innenrüstung. „Was ist denn los?“
Rocky, der eigentlich Hotte hieß und den alle Welt mit dem Kürzel des Boxers ansprach, der mit dem Mundwerk ebenso schnell und unkontrolliert reagierte wie mit den Fäusten, krähte: „Da hat irgend so ‘ne taube Sau seine Jacke reingetan oder so was.“ Tatsächlich hatte der Ausländer, ein stämmiger, blonder Kerl aus Litauen, einen Jackenschoß aus dem Beton gefischt und zog heftig daran. „Zu schwer!“, sagte er zu Rocky. „Du musst helfen.“ Nichts erschien Rocky widerwärtiger, als auf fremdländisches Geheiß in den frischen Beton zu steigen und das Zeug auch noch mit den Händen zu berühren. Doch Meisner drängte: „Nun macht schon. Ich möchte wenigstens Silvester zu Hause feiern.“
Der Blonde sprach recht gut Deutsch; der Sinn von Meisners grimmigem Scherz entging ihm dennoch. Er zerrte an der Wattejacke und hatte doch längst erkannt, dass mehr daran hing. Vielmehr drinhing. Ein Körper nämlich. Der Körper eines
Toten.“
Seinen Kriminalroman „Variante Tramper“ veröffentlichte Klaus Möckel erstmals 1984 in der DIE-Reihe (Delikte, Indizien, Ermittlungen) des Verlages Das Neue Berlin: Ein Kind wird von einem PKW überrollt. Der Fahrer, ein Student, braust einfach weiter, bekommt dann allerdings Gewissensbisse. Seine Mutter aber hindert ihn daran, sich zu stellen. Sie will ihrem Sohn die Karriere nicht verderben und erpresst ihren Bruder, damit er ihnen aus der Patsche hilft. Ein teuflischer Plan wird ersonnen, ein Tramper zum Sündenbock erkoren. Die Kriminalisten, Bothe und Kielstein, sehen sich einem Geflecht aus Lügen und Korruption gegenüber, das sie zunächst nicht zerreißen können. Ein Krimi über Engpässe in der Versorgung und die daraus entstehende Bestechlichkeit. Bei der Aufklärung des raffiniert angelegten Falles werden aber auch das Prestigedenken bestimmter Schichten sowie Jugendprobleme zur Sprache gebracht. Sowohl „Variante Tramper“ als auch „Drei Flaschen Tokaier“ verfilmte das DDR-Fernsehen für seine Reihe „Polizeiruf 110“. „Variante Tramper“ beginnt scheinbar ganz harmlos mit einer Autofahrt auf ein Wochenendgrundstück:
„1. Kapitel
Ralf Jonas gibt Gas und schaltet in den vierten Gang hoch. Der kurvenreiche Teil der Strecke liegt hinter ihm, ab jetzt wird die Straße besser. Er hat es nicht mehr weit bis zum Grundstück, keine acht Kilometer, er kennt bis dorthin jeden Busch. Als die Tachonadel bereits zwischen siebzig und achtzig pendelt, taucht links am Wegrand ein Tramper auf, der mit müder Daumenbewegung nach vorn zeigt. Langes, ungepflegtes Haar, abgeschabte Kordjacke, ein Bündel neben sich am Boden. Er steht gewiss schon eine Weile da, hat sich die dümmste Stelle ausgesucht, um ein Auto anzuhalten. Wo hier jeder beschleunigt, denkt Jonas, und die meisten sowieso die Abkürzung durchs Mühlental nehmen. Außerdem sind die Leute um diese Zeit längst zu Hause oder in ihren Gärten, für wen beginnt das Wochenende denn erst um fünf. Er tritt stärker aufs Gaspedal und prescht vorbei. Auch wenn er bis zur nächsten Stadt oder weiter fahren würde, hätte er nicht angehalten. Solche Typen kann er gerade leiden.
Im Rückspiegel sieht er, dass sich der Bursche resigniert ein paar Meter von der Straße weg ins Gras setzt. Einfach auf den Hosenboden, mit dem er die Polster des nächsten Shiguli oder Mazda drücken will. Aber nicht bei mir, denkt Jonas. Dann richtet er seineAufmerksamkeit wieder nach vorn. Jonas wohnt und arbeitet in Reintal, fährt aber jetzt, im Sommer, fast jeden Abend aufs Grundstück. Meist zusammen mit seiner Frau, die etwa um die gleiche Zeit Schluss hat. Nur heute ist es anders, sie hat schon eher aufgehört und den Mittagsbus genommen. Nach einem Zahnarztbesuch konnte sie das so einrichten. Er biegt von der Straße ab, Fährt die hundert Meter am Waldrand entlang hinunter zum See. Vor dem schmiedeeisernen, erst kürzlich gesetzten Gartenzaun hält er an und hupt kurz. Seine Frau kommt im Bikini hinter einem kleinen Anbau hervor und öffnet. Sie ist vierzig Jahre alt, wirkt aber jünger, fast mädchenhaft. Neben ihrem eher vierschrötigen Mann sieht sie ein wenig zerbrechlich aus.
Jonas, zufrieden, dass er angelangt ist, stellt den Wagen in die Garage. Als er das Gartentor geschlossen hat, hört er im Haus das Telefon klingeln. „Ich geh' schon 'ran“, ruft er seiner Frau zu, die sich an einem Blumenbeet zu schaffen macht, und steht bereits auf der Veranda. Das Telefon schrillt ununterbrochen - die lassen einen selbst am Wochenende nicht in Frieden. Insgeheim fühlt sich Jonas jedoch geschmeichelt. Seine Frau wollte den Anschluss nicht haben, behauptete, dass sie wenigstens hier draußen ihre Ruhe brauche, er aber ließ alle Verbindungen spielen, boxte die Sache durch. Es musste sein, schließlich ist er nicht irgendwer, sondern Leiter einer Verkaufsstelle, die den ganzen Kreis mit Siedler- und Gartenartikeln versorgt. „Was mir zuviel wird, wimmle ich schon ab.“ Und in der Tat, darauf versteht er sich.
Wahrscheinlich Brinkmann, denkt Jonas, der wartet auf seine Dachrinnen, na, soll er ruhig noch 'ne Weile zappeln. Fast heiter gestimmt, hebt er ab. Zu seiner Überraschung meldet sich seine Cousine, Angela Kutscher.
„Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass niemand da ist.“ Ihre Stimme, die sonst männlich fest ist, bebt.
Jonas sagt erstaunt: „Du, Angela? Was ist los? Ich komme gerade zur Tür 'rein.“
„Ich brauche deine Hilfe. Kai-Dieter... Was Schreckliches ist passiert.“
„Na, na.“ Jonas ist keineswegs auf Tragik eingestimmt. Vielleicht wird der Junge Vater, denkt er amüsiert.
„Es ist kein Spaß. Kai-Dieter hat... ein Mädchen überfahren.“
„Was!“
„Ein kleines Mädchen. Vorhin... Bei der Eisenbahnbrücke.“'
„Was heißt überfahren? Ist sie... tot?“
„Das weiß er nicht. Er ist doch weiter mit dem Wartburg. Es ging alles so schnell.“
Fahrerflucht, denkt Jonas, hat aber den Ernst der Nachricht noch immer nicht voll erfasst. Oder genauer, sein Inneres, aufs Wochenende ausgerichtet, wehrt sich dagegen, eine solch hässliche Realität zur Kenntnis zu nehmen.
„Du musst etwas für uns tun“, sagt die Stimme wie aus einer anderen Welt. „Du bist unsere ganze Hoffnung.“
„Ich? Wie stellst du dir das vor? Da gibt's nur eins, der Junge muss zur Polizei.“
„Nein!“ Die Antwort der Frau ist ein Schrei.
„Aber das Kind! Und er ist abgehaun!“
„Ein Unfall. Es lässt sich nicht mehr ändern. Ich will nicht, dass sein Leben daran kaputtgeht.“
„Scheiße“, sagt Jonas, „seine verdammte Raserei.“ Er ist wütend, und zugleich tut ihm der Junge leid, von dem er einiges hält. Kai-Dieter ist begabt, aus ihm könnte was werden.
„Du wirst ihm helfen“, Angelas Stimme bebt stärker, „sonst...“
„Was sonst?“
„Du verstehst mich schon.“
Jonas ist nun völlig da. Dieses Gespräch eignet sich nicht fürs Telefon, denkt er und sagt vorsichtig: „Du würdest dich auch selber hereinlegen.“
„Das wär mir egal. Wenn du uns im Stich lässt, garantier ich für nichts.“
„Was verlangst du?“
„Der Junge braucht jemanden, bei dem er zum entsprechenden Zeitpunkt gewesen ist.“
Darum geht es ihr also, fein hat sie sich das ausgedacht. Verzweifelt überlegt Jonas, was er entgegensetzen kann.
„Du musst sofort herkommen“, sagt Angela.
„Du bist verrückt. Wozu soll das gut sein?“
„Damit wir die Einzelheiten absprechen können.“
„Wann ist es passiert, und was habt ihr seither getan?“ Jonas versucht Zeit zu gewinnen.
„Vor einer halben Stunde erst. Kai-Dieter kam dann sofort nach Hause, und wir haben den Wagen in Lias Garage gestellt. Sie ist nicht da, macht Urlaub.“
Sie hat alles vorbereitet, denkt Jonas, sie lässt mich nicht raus. Aber was sie vorhat, ist viel zu gefährlich und auch zu durchsichtig. Doch innerlich ist er schon bereit mitzuziehn. Plötzlich, fast gegen seinen Willen, kommt ihm ein Bild in den Sinn. Das des Anhalters auf der Landstraße. „Ist Kai-Dieter gesehen worden?“
„Nein. Jedenfalls glaubt er's nicht.“
„Und der Wagen? Ist er beschädigt?“
„Nur wenig. Du hast doch sicher einen neuen Scheinwerfer.“
„Hör mal“, sagt Jonas energisch, „das alles ist zwar heller Wahnsinn, trotzdem werd ich dir vielleicht helfen. Aber nicht so. Weder mit einem Scheinwerfer noch mit einem Alibi, das ist viel zu leicht widerlegbar. Lass den Wagen, wie er ist, und sag, man hat ihn gestohlen. Erfinde was, sag, dass der Junge im Kino war, was weiß ich. Aber erst, wenn sie euch fragen. Sie kommen bestimmt, so auffällig, wie der alte Wartburg ist.“
„Aber du und ich, wir sollten...“
„Gar nichts sollten wir. Wir machen jetzt Schluss, das ist am besten. Ruf auch nicht mehr an. Ich hab da eine Idee. Ich melde mich wieder. Spätestens in einer Stunde.“ Er legt entschlossen auf, das Gespräch hat schon viel zu lange gedauert. Seine Frau steht an der Tür, hat offenbar was mitgekriegt. Aber das ist ihm nicht unrecht. Wenn der Plan, der sich schemenhaft in seinem Hirn abzuzeichnen beginnt, Gestalt annehmen soll, wird sich nicht umgehen lassen, sie bis zu einem gewissen Grad einzuweihen.
„Wir müssen weg“, sagt er, „sofort. Komm, ich erklär' dir's.“
„Was Schlimmes?“
„Gemeiner hätt's uns nicht erwischen können.“
Obwohl Helma kaum den ganzen Ernst der Situation erfasst haben kann, fragt sie sowohl sachlich als auch ahnungsvoll: „Und uns bleibt nicht viel Zeit?“
„Sehr wenig.“
„Ich hab immer gewusst, dass es irgendwann mal auf uns zurückschlägt, immer“, sagt sie.“
„Weg in den Herbst“ – so lautet der Titel der Autobiografie von Uwe Berger, die erstmals 1987 im Aufbau Verlag Berlin und Weimar herauskam: In diesem Buch bemerkt Uwe Berger: „Weil ich so ganz Künstler bin, liebe ich das Leben über alles.“ Sein Leben beginnt in Emden mit dem Duft von Meer und Weite. Augsburg schenkt ihm Mittelalter, Reformation und Renaissance. Berlin konfrontiert ihn mit vielfältiger Kunst. Sein Vater holt ihn im Krieg aus einem Kinderlager in Polen. Mit 15 Jahren steht er am Messgerät einer Flakbatterie. Von einem Flakhelfer hört er die Stimme des Widerstands. In der Hungerzeit nach dem Krieg fährt Uwe Berger aufs Land, um gegen Schnaps Kartoffeln einzutauschen. Ein russischer Soldat hilft ihm, die Kontrollen zu umgehen. An der Universität hört er Hermann Kunisch über mittelalterliche Mystik zelebrieren. Vor der Haustür des Volk und Wissen Verlages zieht man eine weibliche Leiche aus dem Kanal. Im Aufbau Verlag lernt er Autoren wie Friedrich Wolf und Jan Petersen kennen. Mit Würde spricht er von Tod und Liebe und ist beeindruckt vom Ethos des Arztes Theodor Brugsch. Die Autobiografie führt uns zuerst weit zurück an den Beginn des Lebens von Uwe Berger – nach Emden. Und die erste Kapitelüberschrift bekommt auch bald eine ganz andere Erklärung als man wahrscheinlich denken mag:
„Sonne
Immer der Geruch von Teer und Räucherfisch. Das Heulen von Schiffssirenen. Das Haus, in dem wir wohnten, blickte mit der Rückfront zum Hafen. Eine Gasse trennte es von den Lagerschuppen am Kai. Vom Balkon aus konnte man das Ein- und Ausfahren der Logger und das Entladen des Fangs beobachten. Gemächlich bewegten sich Matrosen und Hafenarbeiter. Manchmal schoben sich graue Kriegsschiffe in den Innenhafen von Emden. Die großen Frachter machten im fast unübersehbaren Becken des Außenhafens fest, das durch Schleusen von der Nordsee und ihrem Tidenhub abgeschlossen war.
Mein Vater ging gern mit mir zu einem Wiesenufer, wo viele Schlepper lagen, breite und schlanke, hochbordige und flache. Wir studierten sie ebenso wie die Bugwellen, die die Schiffe machten, wenn sie das Wasser durchschnitten. Ich war fünf oder sechs Jahre alt. Vor dem Einschlafen saß mein Vater bei mir und erzählte mir Geschichten vom Dackel Männe, den er als Kind geliebt hatte, oder vom Krieg in Frankreich, von wo die Hugenotten unter seinen Vorfahren gekommen waren. Als ich einst schwer krank lag und er an mein Bett trat, stürzten ihm die Tränen aus den Augen. Meine Mutter fuhr ihn an, dass er sich beherrschen solle. Aber ich spürte ihre Eifersucht, und mein Gefühl wandte sich ihm zu.
Mein Bruder Peter, sieben Jahre älter als ich, spielte mit anderen Jungen Fußball und schoss mit dem Luftgewehr nach Spatzen oder nach den Ratten, die sich an dem großen steinernen Müllbehälter im Hof zu schaffen machten. Er nahm mich, den so viel Kleineren, als Gefährten nicht an. Mit harten Worten scheuchte er mich aus seinem Zimmer. Das Herz meiner Mutter neigte besonders zu ihrem Erstgeborenen. Ich war ein – vielleicht unerwünschter - Nachkömmling. Bald lernte ich mich selbst beschäftigen, gebrauchte und entwickelte meine Fantasie im einsamen Spiel, suchte mir Freunde und ging innerlich meinen eigenen Weg.
Wir hatten eine riesige Wohnung, die Dienstwohnung des Zweiten Vorstandsbeamten der Reichsbankfiliale in Emden. Von einer Eingangsdiele, die mit rotem Linoleum ausgelegt war und auf deren erhöhtem Teil weiße Flurmöbel standen, gingen nicht nur ein „Esszimmer“, ein „Herrenzimmer“ und ein „Salon“ ab, die selten benutzt wurden, sondern auch Räume, in denen man wirklich wohnte und schlief. An den roten schloss sich ein grüner Flur an, ein langer Gang, der in den hinteren Teil der Wohnung führte, zu weiteren Räumen sowie zur Küche, zur Speisekammer, zur Besenkammer, zur Mädchenstube und zum Wohnzimmer. Es gab eine Bad-Toilette und eine Toilette mit zwei Kabinen und zwei Pissoirs, wie sie einer Gaststätte angestanden hätte. Außer dem vorderen war auch ein hinterer Aufgang vorhanden. In einer Erweiterung des grünen Flurs hingen zwei Seile mit Ringen von der Decke herab. Hier konnten wir schaukeln und turnen. Als ich mein erstes Fahrrad bekam, lernte ich auf dem Flur fahren.
Mit dem Direktor der Bank, einem Mann namens Reichsstein, und seiner Familie, die in der Beletage unter uns wohnten, standen wir nicht gut. Als er und seine Frau einen Höflichkeitsbesuch erwiderten, brachten sie eine gelbe Katze mit. Meiner Mutter passte es nicht, dass das Tier in unserer Wohnung herumstrich. Mit plötzlichem Entsetzen rannte ich vor dem leise gehenden Wesen davon, das mir nachsetzte. Ich flüchtete ins Bad. In der Absicht, die Katze von mir fernzuhalten, schlug ich die Tür mit aller Kraft hinter mir zu. Dabei klemmte ich sie ein. Sie drehte sich im Kreis und starb. Es entstand großer Aufruhr. Meinen Eltern war der Vorfall sehr unangenehm, aber sie wiesen mich kaum zurecht. Meine Mutter rechtfertigte sogar meine Tat. Danach kühlte das Verhältnis noch mehr ab.
Es waren die Jahre vor und nach 1933. Auch nach dem Verbot der Freimaurerei durch die Faschisten gehörte mein Vater einer Loge als stellvertretender Aufseher an. Was er für sie tat, weiß ich nicht. Doch eingeprägt hat sich mir die freisinnig-humanistische, antifaschistische Stimmung in meinem Elternhaus. Man verachtete die Gröler und Schläger und deren Anstifter. Zwischen den Reichssteins, die Nazis waren oder wurden, und uns entwickelte sich eine untergründige, schwelende Feindschaft. Wir Jungen hassten die fetten, rothaarigen Söhne der anderen Familie und vermieden jeden Kontakt mit ihnen. Allerdings, so entsinne ich mich auch, bemerkte meine Mutter einmal sorgenvoll angesichts einer mit roten Fahnen marschierenden Arbeiterkolonne: „Hoffentlich gibt es keinen Bürgerkrieg!“ Die Warnung der Kommunisten, Hitler sei der Krieg, fand kaum Gehör selbst bei den progressiven Bürgerlichen. Was da finster heraufzog, überstieg ja nicht nur die
normale Vorstellungskraft, sondern auch alle Warnungen. Gleich vielen, die nicht ahnten oder wahrhaben wollten, dass das Risiko des Gewährenlassens unendlich viel größer als das Risiko des Widerstandes war, standen meine Eltern abwartend zwischen den Fronten. Solange es ging, zog man sich in die gewohnte Scheinwelt zurück.
Die Härte der tatsächlichen Auseinandersetzungen spiegelte sich im Leben und in den Gewohnheiten der Schulkinder wider. So galt es als ein ungeschriebenes Gesetz, dass in Rangkämpfen der Stärkste der Klasse und damit ihr Anführer festzustellen war. Diese Kämpfe wurden in der Regel mit den Fäusten ausgetragen, was zu blauen Augen und blutigen Nasen führte. Unser Häuptling hieß Franz Vortriede. Wir nannten ihn Sonne, warum, weiß ich nicht. Doch der Beiname passte zu ihm, einem umgänglichen und gescheiten Jungen. Franz war der Sohn eines
Hafenarbeiters. Ich bewunderte, ja liebte ihn. Seinen Vater lernte ich kennen, als wir Grabenkrieg in Flandern spielten. Vortriedes wohnten in einem kleinen Haus, das mit anderen in einer Reihe stand. Vor den Häusern erstreckte sich freies Feld. Bauarbeiter hatten dort für Kabel Gräben gezogen, auf deren lehmigem Grund das Wasser stand. Wir hockten uns mit Stöcken bewaffnet hinein. In umherliegende Bierflaschen füllten wir Grabenwasser und klemmten sie wieder mit den daranhängenden Prozellanverschlüssen zu. Das waren unsere Handgranaten. Wir warfen sie nach den Feinden, die angriffen und zurückgeschlagen wurden. Dass es keine gefährlichen Verletzungen gab, muss man wohl als eines jener Wunder ansehen, die Kinder schützen. Wir tranken auch von dem Wasser in den Flaschen.
Schließlich kam Sonne auf die Idee, nach Hause zu gehen und sich den Stahlhelm und das Seitengewehr zu holen, die sein Vater aus dem Krieg mitgebracht hatte. Er kehrte mit Stahlhelm, doch ohne Seitengewehr zurück. Stattdessen begleitete ihn sein Vater, ein breiter, kräftiger Mann mit rundem Gesicht. Seine Erscheinung, sein Wesen und seine Worte sind mir in Erinnerung geblieben. Kopfschüttelnd ließ er sich unser Spiel erklären. Als er sah, dass ich eine Flasche an den Mund setzte, wohl um ihren friedlichen Zweck zu demonstrieren, zog er mich aus dem Graben, nahm mir die Flasche weg und erklärte mir ruhig, wie gefährlich es sei, solches Wasser zu trinken. „Denk an den Kummer“, sagte er, „den du deinen Eltern machst, wenn du krank wirst.“ Ich spürte seine Väterlichkeit und war verlegen. Jedem von uns erlaubte er, einmal den Stahlhelm aufzusetzen. Dann nahm er ihn an sich und befahl kurz und bündig: „Schluss mit dem Kriegspielen! Das ist kein Spaß ...“ Wir waren aus der Stimmung gerissen, maulten und fügten uns.“
Erstmals 1974 brachte Heinz Kruschel im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik Berlin unter dem Titel „Der Köder. Die Zauberer von Baracoa“ einen Band mit Erzählungen heraus: In den zwanziger Jahren, als die Basmatschen im sowjetischen Zentralasien, unterstützt von den Engländern, mit Terror und Mord einen muselmanischen Staat aufbauen wollten, kämpften Sawrija und Ulug nicht nur um ihre Liebe, sondern auch um das Leben des Dichters, das sie aber nicht mehr retten konnten.
Während des zweiten Weltkrieges wollte ein Sechzehnjähriger nicht glauben, dass sein väterlicher Freund nicht wiederkehren sollte. Er sträubte sich gegen den Befehl, ihn im Interesse der Gruppe aufzugeben, ihrer Aufgabe und der Sache wegen, und er musste sich doch gegen den Freund entscheiden.
Und spät entscheidet sich Boris in den ersten Tagen des bulgarischen Aufstandes, zu spät für seine Mutter Rusha, die von seinen ehemaligen Freunden getötet wurde, aber noch nicht zu spät für den Zug der Gefangenen, die auf dem Wege vom Zuchthaus zum Bahnhof überfallen werden sollten. Noch hörte er das Lied, „das die Räder des Wagens singen werden“.
Das Dorf, in dem Orestes mit Caridad und den anderen Klassenkameraden alphabetisieren sollte, lag im unwegsamen Bergland von Baracoa, und die Menschen lebten dort unter bitteren Verhältnissen. Die Kinder starben früh, weil es an Eiweiß mangelte, die Leute glaubten dem Medizinmann, Epidemien brachen aus, die Konterrevolution gab sich noch nicht geschlagen. Der fünfzehnjährige Orestes musste entscheiden und handeln wie ein Mann. Sogar gegen seinen Pflegevater, der Kuba mit ihm verlassen wollte.
In den vorliegenden vier Erzählungen Heinz Kruschels stehen junge Menschen vor Aufgaben, die unlösbar erscheinen. Sie müssen Entscheidungen treffen, die fast zu schwer für sie sind, die Entscheidungen junger Revolutionäre. Sie müssen über sich selbst hinauswachsen. Kruschel gestaltet vier außergewöhnliche Stoffe in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten. Der Reiz des Bandes liegt in der erregenden Darstellung wie auch in der thematischen, weil internationalen Vielfalt. Der kritische Vergleich des jugendlichen Lesers mit den Helden der Erzählung wird geradezu herausgefordert. Hier der Beginn einer dieser vier ebenso spannend wie politisch geschriebenen Erzählungen:
„Der Köder
Als wenn man einem tapferen Mann Gewalt antun könnte.
Cicero
4. November 1943, vormittags.
Marcel saß auf einem gefällten Buchenstamm und rauchte in hastigen Zügen seine selbst gedrehte Zigarette. Der Tag war kalt und feucht. Es sah so aus, als würde der Nebel nicht weichen, er verhüllte die karge Landschaft. Er dachte: Das Wetter ist richtig für die Aufgabe, was zögern sie noch? Claude weiß, dass er mir vertrauen kann. Weiß er das? Natürlich weiß er es, aber solange wir zusammen sind, ist auch das Misstrauen mit uns unterwegs, es schläft nicht unter dem freien Himmel, es ermattet nicht auf den Märschen in dunklen Nächten, es liegt neben uns am Maschinengewehr, es steht unsichtbar neben Claude, wenn er einen neuen Befehl gibt. Vertrauen kann man nicht in ewige Pacht nehmen, sagt Claude, man muss es immer wieder erwerben. Schärft euch das ein, es ist besser, auch mal grundlos zu misstrauen, als ein leichtfertiges Vertrauen mit dem Tode zu bezahlen. Hat er nicht recht? Natürlich hat er recht, aber dann soll er endlich seine Entscheidung treffen, verflucht noch mal. Entweder sie schicken mich los, ehe es zu spät ist, oder ... Oder sie schicken einen andern. Aber wen denn? Wer kennt sich hier schon aus! Ich weiß die Schleichpfade, kenne jeden Busch und jedes Versteck; sie gehen ein großes Risiko ein, wenn sie mich nicht schicken.
Marcel zerkrümelte die Zigarettenkippe, riss wieder ein Stück von der Zeitung ab, drehte sich eine neue Zigarette, steckte sie an. Kein Laut, nicht einmal das Knacken eines Zweiges. Rief ein Vogel, so klang das kläglich, sein Ruf wurde in dem wattigen Nebel erstickt und versickerte. Schritte waren nicht zu hören, dennoch spürte Marcel, wie zwei Männer auf ihn zukamen. Wenn man so lange illegal arbeitet, bekommt man dafür einen sechsten Sinn, und so überraschte es ihn nicht, als Claude und Heinz vor ihm standen, ihn anblickten und sich zu ihm setzten.
„In Ordnung“, sagte Claude, „du gehst noch heute.“
Marcel drückte die angerauchte Zigarette auf dem nassen Holz aus. Sie zischte leise. „Ihr habt lange gebraucht.“
„Sei nicht ungerecht“, sagte Heinz, „der Auftrag ist nicht leicht.“
Marcel lächelte spöttisch. Ohne zu antworten, sah er den gutmütigen jungen Deutschen an. Dann erhob er sich und fragte: „Wann?“
Claude kniff die Augen zusammen, behielt die Zigarette im Mundwinkel und sagte: „Die Faschisten haben unsere Verbindungsleute aus dieser Gegend verhaftet, vergiss das nicht. Du musst herausbekommen, wann und womit und, wenn möglich, auch wohin sie abtransportiert werden sollen ...“
„Ich weiß, ich kenne die Aufgabe“, unterbrach ihn Marcel.
„Mich interessiert nicht, was du weißt“, sagte Claude ruhig und blickte Heinz an, „dich hat nur das Wann, Wohin und Womit zu interessieren. Verstehst du, nur das! Dich interessieren nicht die Gefangenen, verstanden? Du hast keine Einzelaktion zu unternehmen, hüte dich vor jedem Zusammenstoß, und lass dich nicht provozieren ...“ Claudes Gesicht blieb ohne Bewegung, von diesem hageren Gesicht ließ sich selten eine Regung ablesen. „Du hast maximal vierundzwanzig Stunden Zeit. Es gibt noch einen Streckenarbeiter im Ort, dem wir vertrauen können, aber es kann sein, dass sie ihn absichtlich in Freiheit gelassen haben. Er ist kein richtiger V-Mann. Wende dich erst dann an ihn, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Wir wollen ihn schonen und nicht in Gefahr bringen, alles andere wird Heinz mit dir besprechen, mach deine Sache gut, wir warten hier auf dich.“ Er stand auf und gab Marcel die Hand. „Und sonst?“, fragte er.
Marcel begriff, was gemeint war. „Sonst habe ich schon vergessen, dass ich in diesem Nest auf die Welt gekommen bin.“
„Genau falsch. Denke immer daran, die Gefahr ist nicht gering, man könnte dich erkennen.“
„Ich bin als Bengel von zu Hause weg.“
„Dein Vater lebt noch hier. Du darfst ihn nicht besuchen, du darfst dich nicht nach ihm erkundigen. Triffst du ihn, so hast du ihn nicht zu erkennen.“
Marcel zuckte die Schultern. Für ihn war das klar. Erwarteten sie von ihm noch ein Versprechen? „Ich bin unsentimental“, sagte er, „mein Vater ist nicht richtig im Kopfe, wer weiß, ob er noch lebt.“
„Der Eisenbahner heißt Emile“, erklärte Claude sachlich, „Emile Bergman. Du lässt deine Waffe hier. In vierundzwanzig Stunden also, morgen um diese Zeit, muss der Kurier unserer Zentrale die Meldung überbringen. Der Gefangenentransport wird aufgehalten werden, doch das ist nicht mehr unsere Aufgabe.“ Claude wandte sich um und ging. Nach fünf Schritten hatte ihn der Nebel verschluckt.
„Du hast ihn überreden müssen, nicht wahr?“, fragte Marcel den Freund.
„Jeder ist nur ein Mensch“, meinte Heinz, „dein Vater, deine Familie ...“
„Ein verrückter Vater und eine bigotte Tante ... Er müsste mich kennen, ich bin lange genug mit ihm zusammen.“
„Ich weiß“, sagte Heinz und legte dem Freund begütigend die Hand auf das Knie, „du gehst ja nun auch.“
„Das Nest liegt in einer anderen Welt“, sagte Marcel, „zwischen der Kindheit und dem Heute, mein Gott, was liegt alles dazwischen ...“ Er schloss die Augen. Seine Überlegung war schon auf das gerichtet, was ihn erwartete - er würde die Straßen wiederentdecken, als Fremder in die Gesichter der altgewordenen Bekannten schauen, er würde die Auskünfte einholen und zurückkommen, und er würde Claude trotzdem keinen Vorwurf machen können. Misstrauen ist sicherer als blindes Vertrauen.
„Du hättest an seiner Stelle nicht anders gehandelt“, sagte Heinz.
„Mag sein, aber ich bin nicht an seiner Stelle.“
Heinz bohrte die Stiefelabsätze in das feuchte, modrige Laub und sagte: „Du hast mir beigebracht, dass wir uns keine Gefühle leisten können.“ Heinz hatte, als Siebzehnjähriger aus Deutschland kommend, Marcel in Madrid kennengelernt. Dass er heute noch am Leben war, verdankte er Marcel, den er achtete und nach dem er sich orientierte.
„Das kann man sich immer wieder vornehmen, mein Junge. Aber verbiete dem Baum zu blühen, verbiete ihm, Blätter zu tragen. Was für ein Baum ist das noch? Eine armselige Krücke, ein Zerrbild, nicht wahr?“
„Du möchtest gern alles wiedersehen, ich verstehe das ...“
„Du verstehst einen Dreck. Ich möchte nichts wiedersehen, das Nest kann mir gestohlen bleiben, ich bin nicht gefühlsduselig, dass es mich an die heiß geliebten Stätten der Kindheit treiben würde, mein Gott, wie schlecht kennt ihr mich eigentlich ...“
„Ich würde gern mein Dorf wiedersehen“, sagte Heinz leise.
„Das ist der Unterschied zwischen uns.“
„Ich wäre gern an deiner Stelle gegangen, Marcel. Oder noch lieber mit dir.“
Marcel warf dem Jungen seine Pistole, eine Mauser, zu und meinte: „Ich weiß, Kleiner, aber es ist schon besser so. Du hast Claude zugeredet, hast für mich gesprochen, was?“
„Das ist nicht wichtig“, entgegnete Heinz schroff, „gib auf dich acht. Bis morgen, Marcel.“ ‘
Marcel ging ein paar Schritte, dann drehte er sich um, als hätte er etwas vergessen, und blickte auf den Sitzenden, hob die Hand und winkte. Ein Abschied, dachte er, du liebe Güte, wie oft haben wir einander schon Lebewohl gesagt, und wir haben uns doch immer wiedergesehen. Ich mag diesen Jungen sehr, ich bin sechzehn Jahre älter als er, ich liebe ihn, wie ein Vater seinen Sohn liebt. Ich habe kein Kind. Schon wieder Gefühle, mein Lieber? „In dieser Gegend müsste es Schnecken geben, Heinz“, sagte er laut und lächelte, aber das Lächeln auf seinem Gesicht konnte Heinz von seinem Platz aus nicht wahrnehmen, die Sichtweite betrug weniger als fünf Meter.“
Und haben Sie sich schon entschieden, was Sie lesen werden? Spannend sind alle fünf Angebote – die drei Krimis, die Autobiografie und die abenteuerlich-politischen Erzählungen. Die Entscheidung dürfte also nicht leicht fallen.
Vielleicht sei hier nur noch hinzugefügt, dass kein Geringerer als Bertolt Brecht ein begeisterter Leser, Sammler und Verteidiger von Kriminalromanen war. So lautete eine Notiz aus dem schwedischen Exil im Frühjahr 1941, als sich Brecht zur Flucht nach Amerika anschickte: „Meine beiden Produktionsmittel, die Zigarren und die Kriminalromane, gehen aus und müssen rationalisiert werden.“ Immerhin 290 Kriminalromane stehen heute in seiner Nachlassbibliothek in seinem letzten Wohnhaus in der Berliner Chausseestraße 125, die insgesamt 4218 Bände umfasst.
Brecht las Krimis mit Leidenschaft, zur Inspiration für das eigene Schaffen und fast zu einer Art Therapie. Und fast hätte Brecht sogar selber einen Kriminalroman geschrieben – nach 1934 hatte er sich bereits in Dänemark und gemeinsam mit Walter Benjamin, der ihn dort besuchte, an einem Episodenroman um den pensionierten Richter Lexer – in diesem Nachnamen steckt das lateinische Wort Lex für Gesetz – versucht. Allerdings kam das Projekt über die Anfänge nicht hinaus.
Und Brecht äußerte sich verschiedentlich auch zu den Gründen für den Erfolg der Krimis. Der Kriminalroman habe Regeln zu befolgen, er besitzt „ein Schema und erweist seine Kraft in der Variation“. Und: „Hinter den Geschichten, die uns gemeldet werden, vermuten wir andere Geschehnisse, die uns nicht gemeldet werden. Es sind dies die eigentlichen Geschehnisse.“ Für Brecht war der Kriminalroman ein rationalistisches Experiment, er „handelt vom logischen Denken und verlangt vom Leser logisches Denken“. Und das Denken wiederum war für Brecht das größte Vergnügen der menschlichen Rasse …
Viel Spaß beim Lesen, viel Vergnügen beim Denken und viel Spaß beim Vermuten und Entdecken der Geheimnisse hinter den uns nicht gemeldeten, eigentlichen Geschehnissen und weiter einen schönen „Jahrhundertsommer“ und bis demnächst. Und wer weiß, vielleicht findet man eines Tages doch noch einen echten Brecht-Krimi, den bisher niemand kannte