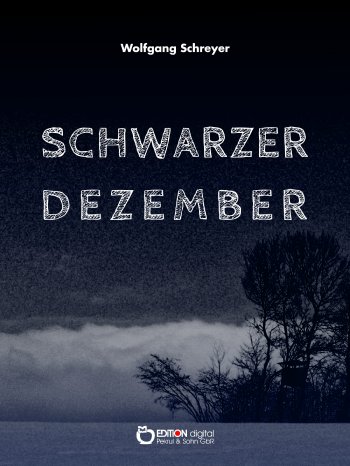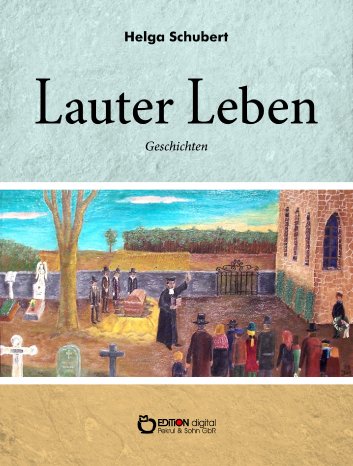Um ein besonderes Filmprojekt und um den Sinn des Lebens geht es in dem Roman „Schwarzer Dezember“ von Wolfgang Schreyer.
In dem kleinen Kinderbuch „Der verlorene Glühstein“ von Carlos Rasch ist jemand dabei, Märchen zu sammeln und ist dazu – mit einer Rakete und einer Reitraupe unterwegs.
Von Liebe und von Sehnsüchten vor allem von Frauen in der ehemaligen DDR erzählt Helga Schubert in ihren bemerkenswerten Geschichten „Lauter Leben“ – mal melancholisch und manchmal auch bitter.
Außerdem wartet am Ende dieses Newsletters noch ein Angebot zum Super-Sondersparpreis von Ulrich Hinse auf alle Newsletter-Empfänger. Aber eben erst am Ende dieser Ausgabe. Und jetzt zurück zu der bereits angekündigten E-Book-Neuerscheinung:
Erstmals im Jahr 2000 war der Kriminalroman „Fahndung am Rennsteig“ von Dietmar Beetz im verlag der criminale erschienen, welchen der Autor mit einer sehr persönlichen Widmung versehen hat: „Meinen Eltern und zum Gedenken an meine Großeltern“. Und darum geht es in dem Buch: Am 31. Januar 1933, einen Tag nach der Machtergreifung, lädt der Juniorchef der Glashütte in Altenroda die gesamte Belegschaft zu einer Siegesfeier in den Gläsernen Hirsch ein. Wenige Stunden später geht die Glashütte in Flammen auf, und Kommissar Kämp fährt mit seinem Kriminalsekretär Degner nach Altenroda am Rennsteig, um die Ermittlungen aufzunehmen. Doch noch bevor er alle Verdächtigen vernehmen kann, liest er in der Lokalpresse, dass die Brandstiftung einen politischen Hintergrund habe. Die Kommunisten wollten ein Zeichen setzen. Und wer deren Anführer ist, ist ohnehin bekannt: der etwas verschlossene Lehrer Bohm aus Weimar. Zudem ist auch Jus Fittich, der Mann von Bohms Geliebter, seit diesem Tag spurlos verschwunden. Dass der einzige Augenzeuge des Brandes, das Dorffaktotum Wurschtweck, seine Erinnerung mit dem Leben bezahlen muss, passt allerdings nicht in diese Theorie. Nach einem Vorspiel beginnt das Buch mit einem Treffen von zwei Kriminalisten früh am Morgen:
„ERSTES KAPITEL
1
Tags darauf, am Morgen des 31. Januar 1933, wurde Kommissar Erwin Kämp in Henneberg, der Kreisstadt am Nordrand des Thüringer Waldes, zu Kriminalrat Oehme, seinem Vorgesetzten, befohlen. Der Kommissar hatte es sich in den Jahren seiner Zugehörigkeit zur Polizei zur Regel gemacht, zwei, drei Minuten vor Dienstbeginn in der Behörde zu sein, und auch der alternde Kriminalrat war offenbar überpünktlich gewesen. So hatte Kämp bereits Hut, Schal und Mantel an den Garderoberechen gehängt, als er Punkt sieben, nach einem Blick in den Taschenspiegel, einer Inspektion seines gefurchten, angespannten Gesichts, zur Tür ging.
An der Schwelle begegnete er Kriminalsekretär Horst Degner, seinem Untergebenen, mit dem er das Zimmer teilte. Der Sekretär - flüchtig oder gar nicht gekämmt, ohne Krawatte, in einer Joppe, die er Windjacke nannte ... Und natürlich wieder mal auf den letzten Pfiff.
„Zum Alten?“, erkundigte er sich.
„Ja, zum Kriminalrat.“
„Wegen der Keilerei im Felsenkeller?“
„Möglich“, gab Kämp, sich abwendend, zur Antwort. Es widerstrebte ihm, zwischen Tür und Angel Dienstliches zu erörtern, und außerdem bezweifelte er, dass Oehme ihn wegen einer Saalschlacht zu sich beordert hatte. Solche Zusammenstöße gehörten eher in das Ressort von Heyder, einem anderen Kommissar der Behörde. Zumindest war es bislang so gewesen.
Kämp hatte den Korridor überquert. Nun zögerte er. Waren seit gestern auch die Kompetenzen anders als bisher, und konnte Heyder, unterstützt von zwei Sekretären, überhaupt all die politischen Schlachten mitsamt ihren Folgen im ganzen Kreisgebiet länger allein bearbeiten? Vielleicht also doch wegen irgendeiner Keilerei?
Der Kommissar klopfte an und wartete auf ein „Herein!“, bevor er eintrat und salutierte. Er trug zwar Zivil, bekannte sich aber zum preußischen Schliff, der ihm in einer Erfurter Kaserne kurz vor dem Weltkrieg, also noch in der Kaiserzeit, andressiert worden war. Kriminalrat Oehme, gleichfalls Beamter der alten Schule, hatte sich hinter seinem Schreibtisch erhoben. Mit der hohen Stirn und den schlaffen Wangen erinnerte er entfernt an Friedrich Ebert, den ersten Präsidenten der Republik, die vor vierzehn Jahren, im Januar 1919, in Weimar aus der Taufe gehoben worden war und, wie die Kommunisten erklärten, mit der Machtergreifung Hitlers gestern den Todesstoß erhalten hatte.
Jetzt reichte der Kriminalrat Kämp ein Blatt Papier. „Bitte, lesen Sie!“ Es war eine der Meldungen, wie sie vom Nachtdienst, meist auf Grund eines Telefonanrufes, notiert wurden. Links oben die Uhrzeit, rechts daneben Name, Tätigkeit und Adresse der Person, von der die Mitteilung stammte. Die hier war null Uhr zwölf aus Altenroda, einem Ort im oberen Kreisgebiet, eingegangen, und erstattet hatte sie ein gewisser Thiel, Oberassistent der Polizei, zuständig für dieses Dorf am Rennsteig. - Die Nachricht von einem Brand der Glashütte dort, wie der Kommissar fand: eine recht alltägliche Meldung.
Um so merkwürdiger - die Art, wie der Kriminalrat ihm beim Lesen zusah. „Na?“, fragte der, als Kämp den Blick hob.
Der Kommissar zuckte die Schultern. „Ein Hüttenbrand oben am Rennsteig, das dritte oder vierte Mal allein im letzten Monat, dass der rote Hahn auf ein Dach geflogen ist.“
Der Kriminalrat nickte. „Stimmt. Nur dass es diesmal um Millionen geht.“
Auch die Höhe des Schadens, meinte Kämp, war nicht derart ungewöhnlich, dass Oehme ihn extra, noch dazu in aller Frühe, vor dem eigentlichen Dienstbeginn, hätte herbeordern müssen, und dass offenbar der Verdacht auf Brandstiftung bestand, der Verdacht auf versuchten Versicherungsbetrug, wenngleich zum Beispiel ein Unfall, eine Havarie, prinzipiell ausgeschlossen werden musste - das war angesichts der Wirtschaftslage erst recht nichts Besonderes.
Der Kriminalrat hatte sich abgewandt, war ans Fenster getreten. Während er durch die Gardine starrte, hinaus in den grauen dämmernden Tag, hielt er die Hände auf dem Rücken - die eine Hand, zur Faust geballt, von der anderen fest umschlossen.
Wie gefesselt, ging es dem Kommissar durch den Kopf. „Hat sich etwa schon die Versicherung gemeldet?“, erkundigte er sich.
Oehme rührte sich nicht, und Kämp wollte die Frage bereits wiederholen, da gab sich der Kriminalrat einen Ruck, kehrte um und sagte: „Nein, noch nicht, und das können wir auch nicht abwarten. Gehn Sie, Kämp, nehmen Sie Ihren Adlatus, den Degner, mit, fahren Sie hoch nach Altenroda und klären Sie die Sache! Die übrigen Ermittlungen erlauben das doch?“
Kämp bestätigte es, wobei er sich straffte, und dann fragte er mit einem Blick zu dem Blatt Papier, das er auf den Schreibtisch gelegt hatte: „Gibt’s vielleicht noch irgendwelche Anhaltspunkte oder Hinweise, etwas außer dieser Nachricht?“
Der Kriminalrat nahm das Blatt, faltete es umständlich zusammen und drückte es dem Kommissar in die Hand. „Nein“, sagte er, ohne ihn anzusehen, „keine. Wenigstens nicht offiziell.“
„Und - inoffiziell?“
Jetzt huschte ein Lächeln über die schlaffen Züge des Kriminalrats. „Kämp, wir kennen einander doch lange genug und wissen beide, dass keiner unserer Fälle ohne besonderen Hintergrund ist. Natürlich habe ich auch bei diesem Hüttenbrand gewisse Gedanken und einen bestimmten Verdacht, zumal mir die Verhältnisse dort oben nicht gänzlich fremd sind, aber wie Sie mich kennen, werden Sie verstehn, dass ich mir lieber die Zunge abbeißen würde, als mit meiner Vermutung, meiner persönlichen Befürchtung den Gang Ihrer Ermittlungen zu beeinflussen, und das heutigen tags entschiedener denn je.“
„Verstehe, Herr Kriminalrat.“ Der Kommissar steckte das Blatt ein und salutierte. „Wir werden umgehend aufbrechen.“
„Eins noch, Kämp, das Sie wissen sollten ...“ Oehme sah den Kommissar fest und melancholisch an. „Solange ich in unserem Kreis für Recht und Ordnung zu sorgen vermag, bin ich zu jeder Tages- und Nachtzeit für Sie zu sprechen.“
1997 veröffentlichte Wolfgang Schreyer im Mitteldeutschen Verlag Halle/Saale seinen spannenden Roman „Schwarzer Dezember“: München, Dezember 1973. Vier Filmleute finden sich zusammen, um irgendwo in der Dritten Welt einen ehrlichen, nichtkommerziellen Fernsehfilm zu drehen: die Aufnahmeleiterin einer Werbeagentur und ihr sehr viel älterer, vitaler Chef, ein Soziologiestudent, Fabrikantensohn mit linken Neigungen, und ein Regisseur, Krimi-Routinier von Ende Vierzig, der sieben Jahre zuvor die DDR verlassen hat. Sie alle suchen das Wagnis oder wollen sogar ihr Leben ändern, ihm wieder einen Sinn geben, der im Glanz und Gedränge des BRD-Alltags, bei der Jagd nach Erfolg unmerklich verloren ging. Dies ist die Geschichte einer Filmproduktion, die als Ausbruch aus gesicherter Existenz beginnt: Aufbruch ins Unbekannte, ins Abenteuer. Jeder der vier hat sein eigenes Ziel, man will Freiheit, Selbstverwirklichung, Ruhm, Liebe oder einfach wieder Geld. Wie soll aus vier verschiedenen Träumen ein gemeinsames Filmwerk werden? Im Mittelpunkt steht der Regisseur Bernsdorff, den der Drang nach Wahrheit, nach freiem und wirksamem künstlerischen Ausdruck von einem Land ins andere treibt, bis über den Ozean, in eine fremde Welt, an den Rand physischer Vernichtung. Der Weg führt in eine gut getarnte Falle. In der Gefahr zerbricht sein Team, doch außer ihm hält noch jemand, wenn auch anders als er — der unerhörten Drohung stand. „Das letzte, was man verliert, ist immer die Hoffnung“, so schließt das Buch. Und es beginnt mit einer merkwürdigen Begegnung und mit einem bemerkenswerten Gedanken von Bertolt Brecht:
„I. Kapitel
Aus dem Haus gehend, verhehlten wir nicht unsere Wertschätzung des scharfsinnigen Zensors. Er war weit tiefer in das Wesen unserer künstlerischen Absichten eingedrungen als unsere wohlwollendsten Kritiker. Er hatte uns ein kleines Kolleg über den Realismus gelesen. Vom Polizeistandpunkt aus.
Bertolt Brecht
1
An diesem Nachmittag im Spätherbst, am Steuer ihres Autos, fragte sich Undine Rauch, wie es nun weiterging. Der letzte Arbeitstag, sie konnte es nicht fassen. Ganz überraschend hatte der Chef erklärt, das Auftragsbuch sei leer, er löse die Firma zum Jahresende auf. Schockiert waren alle, sie war entsetzt gewesen. Man nahm das Schild von der Bürotür und löschte den Namen im Handelsregister, wie einfach. Die Mosaik-Werbefilm GmbH, in der sie es zur Aufnahmeleiterin gebracht hatte, verschwand von der Bildfläche. Zwölf Jahre, und dann aus, vorbei! Sehr väterlich, denn er mochte sie, hatte Fischer ihr das Gehalt bis März gezahlt: Zeit, sich etwas Neues zu suchen. Doch die Branche schrumpfte, und ihr selber fehlte der Schwung; ach, sie hatte Werbung ja so satt.
Der Scheibenwischer schob Schneekrümel weg, durch Fahrtwind und Reifenzischen sagte die Stimme: „Das Verkehrsstudio bittet die Kraftfahrer in Baden-Württemberg und Bayern um größte Vorsicht. Besonders in Waldgebieten besteht Glatteisgefahr durch überfrierende Nässe. Die plötzliche Kälte hat zu zahlreichen Unfällen geführt. Wie uns die Polizei mitteilt, ist auf der Autobahn Salzburg–München nach einer Massenkarambolage die Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Holzkirchen und Hofoldinger Forst voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt. Wir bitten Sie, die Unfallstelle möglichst schon ab Bad Aibling weiträumig zu umfahren.“
An dieser Abfahrt war sie vorbei, es blieb nur noch der Umweg über die Bundesstraße 11. Eine halbe Stunde mehr, soweit sich das ohne Blick auf die Karte sagen ließ. Wie immer seit dem Frühjahr fuhr sie allein, in Rolands schnellem Wagen. Unterhaltung brauchte sie nicht nach der Dreharbeit, die aus so viel Sprechen bestand; höchstens jemanden, der ihr eine Zigarette anzündete oder, wenn nötig, den Weg wies. Doch so ein Lotse konnte lästig sein. Am Steuer tat sie gern das, was sie wollte, es war der einzige Ort, wo man selbst entscheiden konnte. „Am härtesten sind von der Krise die Sportschwimmer betroffen“, plauderte das Radio, als sie die Autobahn verließ. „Ihr Tagestraining von vier bis zu zehn Kilometern können sie nur bei Mindesttemperaturen von fünfundzwanzig Grad im Wasser durchstehen... Sollten Ölmangel und Preisauftrieb anhalten, müssten sie ihre Badehosen ebenso einpacken wie die älteren Badegäste.“
Undine suchte Musik. Die Stimme erinnerte zu sehr an den Mann, von dem sie seit Mai geschieden war. Roland hatte ihr immer gesagt, wie sie fahren sollte. Es hatte ihm nie etwas ausgemacht, sie wie ein Kind zu behandeln. Er war so schlau gewesen, seine Vorschriften als Ratschläge hinzustellen. Er war durchtrieben, selbstgefällig und Regiestar bei der Mosaik; eine verhängnisvolle Mischung. Ein Playboy, der zu oft an mondäne Orte flog, um zwanzig Sekunden geschleckte Reklame zu drehen: aufstrebende Leute aus dem Mittelstand, Paare wie er und sie, gediegene Menschen um die Dreißig, die an exotischen Küsten glücklich waren, weil sie fabelhafte Erzeugnisse genossen. Mit der Zeit hatte er angefangen, seinen Modellen zu ähneln – Einfalt, hochglanzverpackt; kostbare Bilder und leere Worte; rauchzarter Liebeshauch ohne irgendein Gefühl. Ja, er wusste sich darzustellen. Wenn er sich als „Roland Rauch“ präsentierte, spürte man, obschon er nicht rauchte, den Duft der weiten Welt. Und als er ihr zum Abschied den Wagen gab, wie es im Scheidungsurteil stand, hatte er galant seinen Werbespruch zitiert: Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
In Wolfratshausen brannten die Straßenlampen, und noch ehe sie auf der Bundesstraße 11 den Forstenrieder Park erreichte, kam Schneetreiben auf. Das Licht entgegenkommender Autos brach sich, vom Schneefall schraffiert, auf der verschmierten Scheibe. Sie schaltete sämtliche Scheinwerfer ein; acht glitzernde Zeugen der Geltungssucht ihres Mannes. Auf einmal dachte sie: Lutz Bernsdorff! Sie nahm sich vor, ihn aufzusuchen, ihr Weg führte nun sowieso an der Theresienwiese, seiner Gegend, vorbei. Vielleicht hatte Lutz sogar einen Job für sie – etwas beim Spielfilm. Der Sprung dorthin, das war ein alter Traum.
Links vorm Waldrand, zwischen Straße und Bahndamm, lag ein Auto, dick verschneit, halb auf dem eingedrückten Dach; ein flacher Sportwagen, nun flacher denn je. Sie glaubte Fußspuren zu sehen, ein verwischender Eindruck, schattenhaft wie der Gedanke an Hilfeleistung. Immerhin nahm sie den Fuß vom Gaspedal. Zwischen den Bäumen war es dunkel, und sie dachte: Eine Insel suchen. Kein Ziel haben wollen. Nichts rechtfertigen müssen. Einfach so leben. Mit Bacardi-Rum geht alles. Der weiße Rum von den Karibischen Inseln... Nervöse Erwartung äußerte sich bei ihr oft im Hersagen von Texten, die sie verabscheute. Wer zwölf Jahre damit zugebracht hatte, so dumme Sätze betörend zu bebildern, der wurde sie eben nicht mehr los.
Hinter der lang gestreckten Kurve winkte ihr ein Mann. Sie tippte auf die Bremse, gegen ihr Prinzip, und wohl nur, weil sie langsam fuhr. Sie nahm niemals Männer mit. Nach einem hässlichen Schlingern blieb der Wagen stehen. Weshalb hielt sie an? Hatte sie zwischen dem Wrack und dem Winkenden eine Verbindung gesehen, die es gar nicht gab? Es konnte ja kein frischer Unfall sein. Sie aber war einem Schuldgefühl gefolgt, das sich eingestellt hatte, nur weil sie, wie hundert andere vor ihr, an dem Wrack vorbeigesaust war. Der Mann stieg zu, wortkarg, ohne Lächeln. Sie schätzte ihn auf Ende Zwanzig, er wirkte etwas ungepflegt und fahrig. Sein krauser Bart war an den Spitzen merkwürdig vereist.
„Den Bus verpasst?“, fragte sie.
„Ja; das heißt, den Zug.“
Sie nahm eine Zigarette aus der Schachtel am Armaturenbrett, und schon ließ er ein teures Feuerzeug aufschnappen, das kaum zu ihm passte. Er hatte schmale Hände, sein Ärmel war schmutzig; er schien gestürzt zu sein... „Fahren Sie zur Stadtmitte?“
„Fast. Bis zum Ausstellungsgelände. Wo möchten Sie denn hin?“
„Zum Hauptbahnhof.“
Aus. Zum Glück war er nicht schwatzhaft. Der Sprache nach Norddeutscher, sonst hätte sie ihn für einen hiesigen Lehrer gehalten. Das Radio sagte: „Kalte Füße bekommen jetzt auch die Werbeleute der Treibstoff-Firmen Esso und Aral. Mit einer sechsstelligen Summe hatte Esso für die Weltmeisterschaft die bekanntesten Fußball-Nationalspieler zur Absatzwerbung verpflichtet. Nur Bayern Münchens Star Franz Beckenbauer schloss sich aus, denn er wirbt schon mit dem Slogan 'Schönes entdecken' für Aral-Benzin.“
Undine stellte ab, doch nun bedrückte sie die Stille. Der stumme Fahrgast machte sie nervös. Vor Pullach sank die Bahnschranke, nach langen Minuten glitt von links ein Vorortzug heran; den hätte er doch noch erreicht? Das Schweigen wurde peinlich, und plötzlich war es ihr genug. „Arbeiten Sie hier draußen?“
„Nein... Ich studiere noch.“
„Was studieren Sie denn?“
„Soziologie. Aber Sie kommen von der Arbeit?“
„Merkt man das?“
Er nickte unbestimmt. Das Schlusslicht des Zugs verschwand im Wald, die Schranke ging hoch. „Was tun Sie denn?“
„Werbung. Winzige Filmchen fürs Fernsehen.“ Der zweite Grundsatz, gegen den sie
verstieß – über nichts Persönliches reden.
„Außenaufnahmen, bei dem Wetter?“
„Das ist richtig für die Alpen. Wir sind für Rasierwasser schon nach Irland geflogen; heute hat der Wendelstein genügt.“
Es kam nicht das kleine Anerkennungslachen wie sonst, wenn sie davon sprach. Jeder fand Werbung lustig, hielt das für unterhaltsam und einträglich – wer warb, war clever; ein geachteter Beruf. Er aber sagte nur: „Ich filme auch.“
„So zum Spaß?“
„Mehr oder weniger. Mal von der Pike auf gelernt. Kameramann beim Bund; Lehrfilme fürs Militär...“
Rechts schimmerten Häuser, und er bat sie, am nächsten Telefon zu halten. Sie sah ihn die Zellentür öffnen, er nahm den Hörer ab, warf Geld ein, wählte – alles nur mit einer Hand. Ein netter junger Mann, aber etwas stimmte nicht mit ihm.“
1988 erschien erstmals Im Verlag für Lehrmittel Pössneck ein kleines Kinderbuch von Carlos Rasch – „Der verlorene Glühstein“: Pompi von der Erde reiste mit seiner Rakete durchs Weltall, um Märchen zu sammeln. Jede Nacht erzählte Blubli am Lagerfeuer Märchen vom klugen Wull, vom bösen Worr, vom Felsnick, vom Waldgeist Wurzelraun, … bis der Bergdrache Tatz Rothauch die Sonne entzündete. Als er krank wurde, blieb es dunkel. Nur ein Glühstein kann Rothauch helfen, sagte Blubli. Pompi hatte eine Idee. Und so geht es los:
„Der verlorene Glühstein
Pompi, ein reiselustiger Junge, war mit seiner Rakete zwischen den Sternen unterwegs. Da entdeckte er die Welt der Flauschels und landete direkt neben einem Kürbisdorf.
„Ich sammle Märchen“, sagte Pompi, als drei Flauschels angehoppelt kamen und ihn begrüßten. - „Unser bester Märchenerzähler ist Blubli“, erklärten die Flauschels. „Er wohnt am Berg im Wispelwald.“
Pompi walkte auf einer Reitraupe über sieben Hügel zu Blubli, dem Tierballon. Bei den Flauschels gab es nämlich statt Vögel nur Tierballons. Blubli schwebte wie eine Seifenblase am Ufer des Waldsees.“
Unter dem Titel „Lauter Leben“ brachte Helga Schubert Mitte der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Aufbau-Verlag Berlin und Weimar eine Sammlung von Geschichten heraus: 1975, Ostberlin: Helga Schubert war 35 Jahre alt und noch als Psychologin tätig, als sie diesen ersten Erzählungsband mit 31 Texten veröffentlichte. Es sind Geschichten vor allem von Frauen, von alleinstehenden Freundinnen, ihrer Liebe und ihren Sehnsüchten, melancholisch und manchmal bitter. Die Dichterin Sarah Kirsch schreibt in ihrem Nachwort: Und sie ermuntert uns: eher lassen wir uns vom Donner erschmeißen, bevor wir uns mit Verhältnissen begnügen, die nicht menschlich sind. Als Sarah Kirsch ein Jahr später nach der Biermann-Ausbürgerung in den Westen ging, entfernte der Aufbau-Verlag ohne Kommentar das ganze Nachwort. Das Buch aber hatte Helga Schubert da schon bekannt gemacht: Hörspielfassungen und Theateraufführungen basierten auf den Erzählungen, und es erlebte fünf Auflagen. Hier die erste der bemerkenswerten Geschichten von Helga Schubert, erstmals veröffentlich vor nunmehr 43 Jahren:
„Meine alleinstehenden Freundinnen
Meine alleinstehenden Freundinnen kann man unangemeldet besuchen. Meistens ist schon jemand da. Man kann zu ihnen jemand mitbringen. Meine alleinstehenden Freundinnen kommen nie unangemeldet, und wenn sie vorher von der Ecke anrufen. Sie wollen, dass man dann allein ist. Sie bringen niemand mit.
Meine alleinstehenden Freundinnen wohnen in Altbauwohnungen. Entweder im vierten Stock oder zu ebener Erde in einem Laden. Sie sagen, dass sie nicht jeden Dienstag auf dem Wohnungsamt sitzen wollen. Aber in Wirklichkeit wollen sie keine Neubauwohnung. Ihre Wohnungen sind nämlich unverwechselbar.
Meine alleinstehenden Freundinnen sind stolz auf ihre Besonderheit. Darauf vor allem. Ihre Türschilder sind handgemalt, unübersehbar. Neben dem Türschild hängt ein Schreibblock und daneben an einem Bindfaden ein Bleistift, für diejenigen, die vergeblich gekommen sind. In den Wohnungsfluren liegen rote Kokosläufer. An den Flurwänden hängen Zeichnungen, Plakate, Kuckucksuhren. Bei einer steht am Flurende auf dem Fußboden ein zwölfbändiges Lexikon.
Meine alleinstehenden Freundinnen haben auch besondere Toiletten. Sofern sie sich nicht dem Geschmack der Mitbenutzer anpassen müssen. Die eine hat ihre Toilette, im Keller hinter zwei Sicherheitsschlössern, mit Wachstuch ausgekleidet. So sitzt man unter einem Wachstuchhimmel. Bei der anderen muss man erst geradeaus und dann rechtsherum gehen. So gelangt man zum Ziel, das auf einem Podest steht. Von dort sieht man an der Wand Bilder von Strumpfpackungen. Bei einer dritten alleinstehenden Freundin muss man erst das Fahrrad vom Toiletteneingang zum Kochherd schieben. So sieht man immer, wenn besetzt ist.
Die Küchen meiner alleinstehenden Freundinnen sind auch ihre Wasch- und Frühstücksräume. Die Küchenwände sind mit Farbfotos von Kochrezepten, Zwiebelbündeln sowie Hängeregalen mit Zwiebelmusterporzellan geschmückt. Die Tischdecken auf den Küchentischen sind blau kariert. Die Küchenschränke und -stühle sind selbst lackiert, rot oder weiß. Sie haben sich einen kleinen Elektroboiler und zum Ansehen einen dreiteiligen Spiegel daneben anbringen lassen.
Die Wohnzimmer meiner alleinstehenden Freundinnen fallen durch breite Liegen auf. Diese Liegen sind mit Teppichen oder Samtdecken und Kissen bedeckt. Daneben Glasvitrinen mit Nippes von den Großmüttern. Die Fernsehapparate, versteckt zwischen Büchern, übersieht man leicht. Meine alleinstehenden Freundinnen wollen keine Übergardinen. Beleuchtungskörper sind Architektenarbeitslampen an der Wand. Die Wände sind weiß gekalkt und voller Bilder, sodass sie die Wände nicht so oft kalken müssen. Die Bilder sind eingetauscht oder in Großmut gekauft. Manchmal auch selbst gemalt. Eine Ikone hängt auch dabei, falls es IHN doch gibt.
Meine alleinstehenden Freundinnen gehen nicht zum Friseur, besitzen aber heimlich Lockenwickler. Sie schneiden sich ihre Haare gegenseitig. Meinen alleinstehenden Freundinnen ist es ganz egal, was sie anhaben. Und nur zufällig passt das Samthosenbraun zum Pulloverocker. Sagen sie. Für ihre Augen geben sie viel Geld aus. Für Lidpuder und - schatten, für Eyeliner, kleine Pinsel, für kuss- und tränenfeste Wimperntusche. Wenn sie schon nichts für sich tun, müssen sie wenigstens etwas für sich tun.
Meine alleinstehenden Freundinnen haben, sofern sie nicht kinderlos sind, ein Kind. Die Kinder brauchen nicht so viel aufzuräumen, müssen nicht so früh ins Bett wie andere Kinder und gehen ebenfalls nicht zum Friseur. Die Kinder sind immer dabei. Meine alleinstehenden Freundinnen wollen ihre Kinder antiautoritär erziehen, aber die Kinder danken es ihnen nicht so, zunächst.
Die Kinder ähneln ihren Vätern. Und da ist der Haken. Mit den Vätern ihrer Kinder ist es im Guten auseinandergegangen. Sagen sie. Aber meistens wollten die Männer bleiben. Das betonen meine alleinstehenden Freundinnen. Darum würden diese Männer sie auch auf der Stelle wieder heiraten oder überhaupt heiraten. Wenn diese Männer nicht schon wieder verheiratet oder noch verheiratet wären.
Meine alleinstehenden Freundinnen vertreten die Meinung, dass man einmal im Leben verheiratet gewesen sein muss. Wenn sie keinen Freund haben, sagen sie, dass sie auf keinen Fall jeden Tag einen Mann in der Wohnung ertragen könnten. Wenn sie einen Freund haben, wohnt er bei ihnen. Aber unangemeldet. So viel Freiheit brauchen meine alleinstehenden Freundinnen.
Wenn meine alleinstehenden Freundinnen einen Freund haben, werden sie traurig. Weil sie ihn lieben, wie das auch klingt. Weil die Liebe so anstrengt. Dieser soll wirklich der letzte Versuch sein, bei ihm bleiben sie. Auf ihn hat sich das Warten gelohnt. Alles dies hoffen sie. Jedes Mal. Alle. Und die Freunde spüren zwar die Hoffnung, aber noch mehr die Anstrengung und werden misstrauisch.
Meine alleinstehenden Freundinnen finden sich nicht schön. Zum Ausgleich sind sie viel netter, als sie es wären, wenn sie sich schön fänden. Darum nimmt ihnen auch niemand diese Überzeugung, nicht einmal ihre Freunde. Oder, darum nehmen gerade ihre Freunde ihnen diese Überzeugung nicht.
Meine alleinstehenden Freundinnen nehmen die Pille. Aber gleich zu Anfang sagen sie das ihren neuen Freunden nicht. Weil die sich sonst ihr Teil denken. Die denken sich schon genug Teile beim Studium der vorhandenen Buchwidmungen. Aber so etwas sammelt sich eben an.
Am Beginn einer neuen Epoche machen meine alleinstehenden Freundinnen einen vorläufigen Abschiedsbesuch. In nächster Zeit werden sie nicht kommen können und vielleicht auch nicht anrufen, eventuell sogar das Telefon abstellen und den Schreibblock von der Korridortür wegnehmen. Denn es könnte ihn stören.
Im Hinausgehen geben meine alleinstehenden Freundinnen noch eine kurze Einschätzung. Er ist endlich einmal ein ganz normaler Mensch, sodass sie für die Fisematenten der anderen Männer kein Verständnis mehr aufbringen können. Er hat in der richtigen Reihenfolge gelebt, erst für den Beruf, jetzt für eine Frau, von der er Gott sei Dank weiß, wie er sie zu nehmen hat. Er ist ein stämmiger Adonis, der nicht zu viel denkt. Oder er ist ein Mann, der sich nicht diesen Leistungsmarotten, diesem Autofimmel unterordnet, ein nachdenklicher und sensibler Mensch, der sie versteht und nicht gleich an das Bett denkt. Er hält die Ehe nicht für eine moderne Form des Zusammenlebens. Will aber den Glauben anderer Menschen, die daran einen Halt suchen, nicht zerstören. Darum lässt er sich auch nicht scheiden, was meine alleinstehenden Freundinnen verstehen. Vorerst.
Meine alleinstehenden Freundinnen ernähren sich sowie ihr Kind selbst. Ihre Arbeit macht ihnen Spaß. Sie sind fleißig. Ihre Arbeit ist ihnen wichtig, weil sie ihr einziges Außerhalb ist. Nach den Männern. Im Interregnum. Darum fallen sie auch im Beruf auf Lob und Tadel herein.
Meine alleinstehenden Freundinnen haben es nie mit ihrem Chef. So was nutzen sie nicht zu so was aus. Meine alleinstehenden Freundinnen machen im Urlaub weite Reisen. Sie sind sehr neugierig und fahren immer woandershin. Aber sie trampen nur, wenn sie noch jemand bei sich haben. Besonders abends soll man nicht allein trampen, weil sonst was passieren könnte. Sie sind schon mal in eine ganz andere Richtung gefahren, nur weil der Lkw-Fahrer gesagt hat, dass er nicht an die polnische Ostseeküste fährt, sondern woandershin und es dort viel schöner ist als da, wo er nicht hinfährt. So lernen sie die Welt kennen.
Meine alleinstehenden Freundinnen kann man um etwas bitten. Sie leihen einem ein Ohr oder ein Buch, je nachdem. Wenn sie Geld hätten, würden sie auch das borgen.“
Bleibt schließlich noch der angekündigte Titel von Ulrich Hinse, der in dieser Woche zum Super-Sondersparpreis von nur 99 Cent zu haben ist. Es ist sein erstmals 2013 bei der EDITION digital erschienener Staatsschutzroman aus Mecklenburg-Vorpommern „Blutiger Raps“: In diesem Buch schildert der Autor, der vor einigen Jahren als Kriminaldirektor die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes in Mecklenburg-Vorpommern leitete, die Auseinandersetzung zwischen einer gewaltbereiten rechtsextremen Skinheadkameradschaft und einer linksautonomen Wohngemeinschaft, sowie die Versuche der Gesellschaft, ein wirksames Mittel gegen die eskalierende Gewalt zu finden. Ohne sich um die Gesellschaft und die Gesetze zu kümmern, machen die radikalen Jugendlichen ihr Ding. Da werden Graffiti geschmiert, Friedhöfe geschändet, es wird gekifft, aufeinander eingeprügelt und Obdachlose werden ermordet. Ohne Rücksicht. Bis sich die radikalen Jugendlichen mit den Falschen anlegen. Während die offiziellen Präventionsgruppen diskutieren, ohne zu Ergebnissen zu kommen, handelt die russische Mafia. Ein spannender Roman, der sich an tatsächlichen Ereignissen in Mecklenburg-Vorpommern orientiert und bei dem ein Teil der Gewalttäter ein blutiges Ende findet. Gleich am Anfang findet sich der Leser in einer gefährlichen, sich zuspitzenden Situation wieder. Und wahrscheinlich würden die meisten Leute auch einen Bogen um die sich entwickelnden Auseinandersetzungen zwischen Timo und den anderen machen, die er anfangs nur beobachtet:
„DIE WOHNGEMEINSCHAFT
Timo saß auf den steinernen Stufen der Kirchentreppe und beobachtete den Informationsstand der „Kameradschaft Adlerhorst“, der mitten auf dem Marktplatz der mecklenburgischen Kleinstadt aufgestellt worden war. Vor zwei Stunden waren die fünf Skinheads gekommen, hatten einen großen Sonnenschirm und einen Tapetentisch aufgestellt, eine Vielzahl von Broschüren exakt ausgerichtet auf dem Tisch verteilt und zum Schluss zwei große Laken aufgespannt, auf denen in großen gotischen Buchstaben zu lesen war: Das Boot ist voll - Arbeit nur für Deutsche - und - Bürger wehrt Euch - Keine Graffiti -. Adrett sahen sie aus, die fünf Skinheads. Die Glatzen frisch poliert, weiße Oberhemden mit schwarzer Krawatte, schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, die mit zwei halben Schlägen aufgekrempelt den Blick auf die glänzenden schwarzen Springerstiefel mit den weißen Schnürsenkeln ermöglichten. Herausfordernd musterten sie die vorbeihastenden Menschen, die am Samstagmittag in der Innenstadt noch ihre Wochenendeinkäufe erledigten. Lediglich ein älteres Ehepaar hatte den Stand aufgesucht und sich auf ein Gespräch eingelassen.
Es war keine kontroverse Unterhaltung, stellte Timo fest und hatte den kritischen Seitenblick der Alten sehr wohl bemerkt. Es war dabei auch um ihn gegangen, nachdem alle sieben unverhohlen zu ihm herüber geblickt und er die Handbewegung des größten und kräftigsten der Skins richtig gedeutet hatte. Er war so ganz anders. Nicht dass er wesentlich mehr Haare auf dem Kopf gehabt hätte wie die fünf Kameraden unter dem Sonnenschirm. Seine Frisur bestand aus einem drei Zentimeter breiten Streifen, der von der Stirn bis in den Nacken lief. Über der Stirn waren die Haare grasgrün, wechselten in der Mitte zu einem karmesinrot und endeten im Nacken quittegelb. In den Augenbrauen und in den Ohrläppchen blinkten Piercingringe. Seine verwaschene Jeansjacke, die eine Waschmaschine schon lange nicht mehr gesehen hatte, war ausgefranst und die Knöpfe waren auch nicht mehr vollzählig. Auf dem schmuddeligen T-Shirt, es dürfte vor längerer Zeit einmal weiß gewesen sein, war mühsam das Wort „Antifa“ zu lesen. Die schlabberige Hose war zerrissen und die ausgelatschten Turnschuhe hatten schon lange keine Bürste mehr gesehen.
So saß er auf den Kirchenstufen und hatte den Leinenbeutel mit seinen Habseligkeiten neben sich gelegt. Sein Hund, ein Produkt aller freilaufenden Hunde der Stadt und wenig Angst einflößend, hatte es sich neben ihm bequem gemacht, seine Schnauze auf den Beutel gelegt und schlief. Bruno, so hieß der Hund, hatte sich im Gegensatz zu dem älteren Ehepaar nicht von dem voluminösen Rülpser stören lassen, mit dem Timo seinem Völlegefühl nach dem letzten Schluck Bier aus der Dose Luft gemacht hatte. Just zu dem Zeitpunkt, als das Ehepaar an ihm vorbeigegangen war. „Haste mal ne Mark?“, hatte er den alten Mann angequatscht, als dieser mit seiner Frau an ihm vorbeiging. Der hatte aber nicht reagiert und war so eilig weitergegangen, dass seine Frau, die in jeder Hand eine schwere Einkaufstasche schleppte, kaum nachgekommen war.
Timo fand, dass der Rülpser die richtige Antwort darauf war. Diese Spießer gingen ihm auf den Keks. Deshalb wunderte er sich auch nicht, als ausgerechnet die beiden die ersten Besucher des Infostandes waren. Timo griff in den Leinenbeutel, zog eine neue Dose heraus und riss sie auf. Das Bier war warm geworden, schäumte aus der Dose und tropfte auf das T-Shirt und die Hose. Es war ihm egal. Er lehnte sich zurück, blinzelte in die Sonne, kaute an den Fingernägeln, spülte die kleinen Hornraspel mit einem großen Schluck hinunter und verschaffte sich erneut mit einem Rülpser Erleichterung.
Die fünf Adretten am Tisch mitten auf dem Platz kannte er. Er war mit ihnen zusammen zur Schule gegangen, bis sich ihre Wege trennten, als er zum Gymnasium gewechselt war. Der mit der wegwerfenden Handbewegung war Daniel Speck - Nomen est omen -, der sich von seinen Freunden seit einiger Zeit Dolph rufen ließ. Schon in der Grundschule, er und Timo waren in die gleiche Klasse gegangen, hatte er das große Wort geführt und jedem Prügel angedroht, der nicht blitzschnell seiner Meinung war. Wer nicht schnell genug reagierte merkte, dass es nicht nur bei einer Drohung blieb. Schon allein deshalb hatte Timo ihn nie gemocht und war ihm aus dem Weg gegangen. In Erinnerung blieb ihm aber, dass Dolphs Schläge um ein Vielfaches besser waren, als seine schulischen Leistungen. Der Nazi hatte schon immer schlagende Argumente, fiel ihm dazu ein und zog noch einen großen Schluck aus der Dose ab.
Die vier anderen Skins waren jünger. Sie stammten alle aus dem gleichen Wohnviertel, der tristen Plattenbausiedlung im Südosten der Stadt mit ihren stupiden, stark renovierungsbedürftigen Fassaden, und wohnten noch bei ihren Eltern in den Wohnblocks, in denen fast sechstausend Menschen zusammengepfercht lebten. Das heißt, eigentlich stimmte das gar nicht mehr. Viele Wohnungen waren in den letzten Jahren frei geworden und teilweise wohnten in den großen Wohnblocks nur noch fünf oder sechs Familien. Da, wo zu sozialistischen Zeiten die Wohnungen bezahlbar waren, lebten heute nur noch diejenigen, denen das Geld für ein eigenes Häuschen am Stadtrand oder in den Dörfern der näheren Umgebung fehlte. Viele waren auch in andere Bundesländer gezogen. Dorthin, wo es Arbeit gab.
Er selbst hatte sich noch vor dem Abitur davongemacht. Seinen Eltern war es egal gewesen. Vielleicht hatten sie sich sogar gefreut. Vielleicht hatten sie es auch noch gar nicht bemerkt. Sein Vater, eigentlich war es sein Stiefvater, hatte, als sein Arbeitsplatz nach dem Zusammenbruch eines Faserplattenwerkes weggefallen war, in Berlin eine Arbeit gefunden und kam seit dieser Zeit nur noch sporadisch zu Besuch. Das war nicht weiter schlimm gewesen, da er sich sowieso wenig um ihn gekümmert und wenn dann nur Stress wegen seines Aussehens gemacht hatte. Seine Mutter arbeitete bei einer Gebäudereinigungsfirma, musste immer früh zur Arbeit und hatte noch nie Zeit für ihn gehabt. Die ständige Abwesenheit seines Stiefvaters hatte sie nicht sonderlich gegrämt, und da das Geld immer knapp gewesen war, dürfte sie über den Auszug ihres Sohnes nicht sonderlich traurig gewesen sein. Seit er in dem heruntergekommenen Altbau in der Stadt zusammen mit seinen Freunden hauste, hatte er sie nicht mehr gesehen.
„Hey, du Zeckensau, mach dich vom Acker, oder wir helfen dir dabei.“ Timo wurde unsanft aus seinen Gedanken gerissen. Einen Moment hatte er nicht aufgepasst und schon standen sie vor ihm. Bruno drückte seine Schnauze fester auf den Leinenbeutel und tat so, als wenn er fest schlief.
Vorsichtig sondierte Timo die Lage. Dolph und der Jüngste aus seiner Gruppe standen weiterhin am Infostand und unterhielten sich mit zwei neuen Besuchern. Normalos, registrierte Timos Unterbewusstsein. Von denen war im Ernstfall keine Hilfe zu erwarten. So entschloss er sich nichts zu tun und einfach abzuwarten, nahm noch einen Schluck aus der Dose und rülpste erneut. Es klang nicht erleichternd, sondern eher gequält. Er wollte damit seine Verachtung gegenüber den drei Rechten zum Ausdruck bringen, hatte aber gleichzeitig Angst, sie würden auf ihn einschlagen.
Die Haltung der Skins war bedrohlich. Der in der Mitte wippte mit der rechten Schuhspitze auf und ab. Gleichzeitig schlug er leicht mit der rechten Faust in seine flache linke Hand. Die beiden anderen hatten ihre Beine leicht gespreizt und die Hände in Höhe des Bauchnabels in die Gürtel gesteckt.
„Mit deinem Gestank verpestest du die Luft auf dem Marktplatz. Wenn du nicht willst, dass wir dir das Laufen beibringen, verpiss dich sofort und nimm die leeren Bierdosen gleich mit.“ Der Wortführer hatte laut gesprochen und die ersten Passanten blieben in gebührendem Abstand stehen und schauten zur Kirchentreppe hinüber.
„Ihr Naziärsche seht zwar so aus wie Bullen, seid aber keine. Ich kann hier sitzen, wie ich will und nicht wie ihr wollt. Also haut wieder ab.“
„Du Zeckensau hast mich wohl nicht richtig verstanden“, brüllte der Wortführer laut los und blicke sich herausfordernd um. Die Zahl der Zuschauer wuchs. Dolph hatte am Infostand seine Unterhaltung unterbrochen und betrachtete mit beiden Fäusten auf den Tapeziertisch gestützt die Szene, wobei sich die Tischplatte bedenklich durchbog. Er machte aber keine Anstalten, selbst einzugreifen.
Schlagartig wurde Timo klar, dass die drei Figuren vor ihm von Dolph einen Auftrag bekommen hatten und der beobachtete, wie sie mit der Situation fertig wurden. Das machte ihm Mut.
„Dein dummes Gebrüll war nicht zu überhören, arrogantes Nazischwein“, kreischte Timo zurück, „was bläst du dich so auf wie ein Ochsenfrosch. Bist du nicht in der Lage, alleine etwas zu unternehmen. Brauchst du immer Hilfestellung durch mehrere?“ Sein mittleres Gegenüber lief rot an. Jetzt sieht er aus, wie die Nazifahne. Schwarz - weiß - rot, schoss es Timo durch den Kopf.
„Jetzt ist Schluss mit Reden. Du bist in einigen Augenblicken verschwunden oder ich dresche dir neben den bunten Haaren noch eine rote Nase und blaue Augen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei …“
Die Drei erstarb dem Skinhead auf den Lippen. Seine Begleitung hatte in der Zwischenzeit gewechselt. Die beiden „Normalos“, ein untersetzter Mann von etwa 40 Jahren mit seinem gut zehn Jahre jüngeren, erkennbar sportlich durchtrainierten Begleiter, die vor wenigen Augenblicken noch am Infostand mit Dolph gesprochen hatten, hatten sich neben dem Wortführer aufgebaut. Dessen beide Helfer hatten sich verdrückt. Irritiert schaute der Skin erst nach rechts und dann nach links. Die Situation hatte sich für ihn deutlich negativ verändert.
„Können wir helfen? Werden Schlichter gebraucht?“ Freundlich erkundigte sich der Ältere der beiden Männer, wobei er seinen Blick abwechselnd auf den Skin und auf Timo warf. Der Skin schielte über die Schulter zum Infostand. Dort hatte sich Dolph nicht von der Stelle gerührt. Er wurde unsicher, wollte aber die Situation für sich retten und natürlich auch vor Dolph bestehen.
„Nein, ich werde mit der Sache alleine fertig. Sie werden hier nicht gebraucht. Wenn Sie keinen Ärger haben wollen, verschwinden sie jetzt.“
Der Jüngere der Neuankömmlinge drückte dem Skin eine ovale Dienstmarke vor die Augen. „Wenn hier jemand Ärger bekommt und nicht augenblicklich verschwindet, dann bist du das. Also, was ist jetzt?“
„Ist das ein Platzverweis?“, wollte der Skin wissen und befand sich schon fast auf dem Rückzug.“
Aber wie geht es weiter? Diese erste kleine Auseinandersetzung ist erst der Anfang eines viel härteren Kampfes, dessen literarische Verarbeitung tatsächliche Geschehnisse in Mecklenburg-Vorpommern aufgreift. Und mit dem Abstand von einigen Jahren und anderen Ereignissen, die inzwischen hierzulande und anderswo passiert sind, liest sich dieser Staatsschutzroman aus Mecklenburg-Vorpommern noch einmal ganz anders. Eine durchaus aufschlussreiche Lektüre. Und vielleicht gibt es da noch mehr Zusammenhänge mit dem ersten Angebot dieses Newsletters als man auf den ersten Blick geahnt hätte …
Aber auch die anderen vier Angebote sind jedes auf seine Art mehr als nur das Anschauen wert. Also viel Spaß beim Lesen und Entdecken, immer noch weiter einen schönen „Jahrhundertsommer“ und bis demnächst.