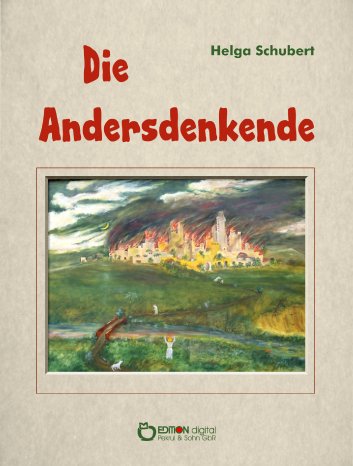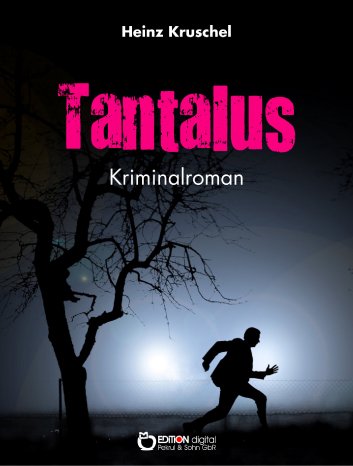Und vielleicht ist es manchmal trotzdem gut, sich an das Leben und an die Leute in dem kleineren östlichen Teil des heutigen Deutschland zu erinnern und daran, wie alles gekommen ist, so wie es gekommen ist. Und vielleicht beantwortet das Lesen von Büchern aus und über die DDR und ihre Folgen auch einige der Fragen, die mit den Ergebnissen der diesjährigen Bundestagswahlen gestellt wurden und noch werden. Gelegenheit dazu bieten jedenfalls - auf allerdings sehr unterschiedliche Weise - die fünf Deals der Woche, die im E-Book-Shop www.edition-digital.de eine Woche lang (Freitag, 29.09. 17 – Freitag, 06.10.17) zu jeweils stark reduzierten Preisen zu haben sind. Die fünf Bücher stammen von vier Autoren, von drei Autorinnen und von einem Autor. Und sie erlauben ganz ungewöhnliche Blicke auf das kleinere Deutschland – vom Leben auf dem Lande bis nach Westberlin. Was Westberlin mit der DDR zu tun hat? Im Falle der ersten Geschichte des zweiten Buches von Helga Schubert, „Die Andersdenkende“, geht es um einen damals unerhörten Vorfall. Damals – vor nunmehr fast 50 Jahren. Aber begeben wir uns zunächst aufs Land, zur Familie von Martin, Martin mit den zwei linken Händen …
Erstmals 1982 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Martin oder Zwei linke Hände“ von Barbara Kühl: Dem zwölfjährigen Martin geht es nicht gut. Er scheint ein richtiger Versager zu sein – zwei linke Hände. Alles, was er auch anpackt, geht schief. Selbst seine besten Vorsätze verkehren sich in ihr Gegenteil. Und als ihm schließlich auch noch seine ältere Schwester Evelyn vorgehalten wird, die viel bessere Zensuren auf dem Zeugnis hat als er, da fühlt er sich selbst als ein Versager. Da er nicht mit in den gemeinsamen Familienurlaub fahren darf, verbringt er zwei Ferienwochen bei seiner Tante Wally Pfeffer, die der LPG-Vorsitzende wegen ihrer lockeren Zunge Wally „Pfefferschote“ nennt. Mit ihr versteht er sich gut, viel besser als mit seinen eigenen Eltern. Und Tante Wally ist es auch, die ihm hilft, als Martin beschließt, von zu Hause wegzugehen, ganz weit weg …
Einen kleinen Eindruck von diesem auch heute noch sehr lesenswerten Buch vermittelt ein Stück aus dem zweiten Kapitel, in dem es allerdings vor allem um Martins Mutter geht, um Maria Lembke. Und der erwähnte Vorsitzende ist der Vorsitzende der LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft:
„Als Maria Lembke in das Zimmer des Vorsitzenden stürmte, um sich für ihre Verspätung zu entschuldigen, hockte Poltrin hinter seinem Schreibtisch, eingenebelt in dicken Tabaksqualm. „Maria, endlich!“, stieß er hervor, sprang auf und schwenkte einen Bogen Papier. „Es hat geklappt! Du, die nehmen unsere Versuche wirklich ernst im Institut, die haben die Sache angekurbelt. ,Jushnij‘ heißt der Kolchos, liegt in der Ukraine, dicht bei Kiew. Hier, hier ungefähr muss das sein!“ Poltrin zerrte seine überraschte Mitarbeiterin zum Schreibtisch und pikte mit dem Pfeifenstiel aufgeregt auf die riesige Landkarte. Maria starrte auf den grünen Fleck und lächelte. Er freut sich, dachte sie, Poltrin freut sich wie ein kleiner Junge über ein neues Spielzeug. Und sie gönnte ihm das von ganzem Herzen.
„Maria, Mädchen, sag doch was!“ Der Vorsitzende richtete sich auf und sah seine Mitarbeiterin begeistert an. „Freust du dich denn gar nicht?“ Natürlich, wollte Maria sagen, doch sie hustete plötzlich los, und der Qualm trieb ihr die Tränen in die Augen. „Weiß schon, weiß schon.“ Poltrin rannte zum Fenster und riss es auf. „Du rauchst nicht, du trinkst nicht ..., wir werden international, und du hustest bloß. Was bist du nur für ein Mensch, Maria? Na, setz dich!“
Heidi Brüsch brachte Kaffee und verschwand wortlos, als sie merkte, dass sie hier überflüssig war. „Also nun mal im Klartext, Rudi“, forderte Maria, „was genau ist los?“ Und Poltrin erwähnte die Haltungs- und Fütterungsversuche, die die LPG Tierproduktion Pierstorf seit Jahren im Auftrag eines Forschungsinstitutes der DDR durchführt, er erzählte vom Kolchos „Jushnij“ in der Sowjetunion, der ebenfalls Jungrinder aufzieht und an einem Erfahrungsaustausch mit einem Betrieb in der DDR interessiert ist.
„Und der Betrieb sind wir! Wir, Maria, und nicht irgendeiner! Hier steht’s drin, im Brief von den Jushnij‘-Leuten. Lies mal.“ Und während der Vorsitzende Maria Lembke den Bogen hinüberschob, murmelte er: „Jushnij ..., Jushnij ..., müsste was mit ,Jugend‘ zu tun haben, oder?“ Maria verschluckte sich fast vor Lachen. „Süden“, sagte sie, „das heißt ganz einfach, Süden‘!“ „Siehst du, Maria, dafür brauch ich dich. Du übersetzt mir den Brief, damit wir den Freundschaftsvertrag aufsetzen können. Und den übersetzt du mir dann auch gleich wieder. Und so weiter. Klar?“
Verdattert sah Maria ihren Chef an und den wie eine Pistole auf sie gerichteten Pfeifenstiel, betrachtete das Stück Papier mit den kyrillischen Buchstaben, blickte wieder hoch und schüttelte den Kopf. „Unmöglich!“
„Nichts da, Kollegin Lembke, du machst das!“ „Ganz unmöglich!“, protestierte Maria noch einmal, „meine Sprachkenntnisse …“ „Sind die besten unter allen Mitarbeitern! In deiner Kaderakte steht es schwarz auf weiß: Berufswunsch — Dolmetscherin. Studium ein halbes Jahr vorfristig abgebrochen. Weitere Einwände?“
„Gottfried ..., seine Verletzung. Hast du das vergessen?“ Poltrin brauste auf. „Ich bitte dich, Maria, die Sache ist bereits ein Jahr her! Dein Mann ist in seinem Beruf voll arbeitsfähig, trotz der Prothese. Willst du dich für alle Zeiten zu seinem Kindermädchen machen? Hast du nicht schon einmal verzichtet — auch seinetwegen?“ Das waren harte Worte, und sie trafen Maria Lembke besonders schwer, weil sie spürte, dass Poltrin recht hatte. Trotzdem versuchte sie es noch einmal. „Ich hab zwei Kinder, und der Martin ist in einem Alter ..., der braucht mich jetzt besonders.“ „Gleich weine ich vor Mitleid, huh-huh!“ Poltrin lief rot an. „Wenn mir Heidi Brüsch das gesagt hätte, alleinstehend mit einjährigen Zwillingen, gut. Aber du, Maria? Komm doch endlich mal auf die Erde! Du kannst sowieso nicht ein Leben lang wie ein Sputnik nur um deine Familie kreisen. Sie ist wichtig, ja, aber nicht das Wichtigste überhaupt. Und jetzt bist du wichtig.“ Und während der Vorsitzende der LPG Tierproduktion Pierstorf in seine dicke Joppe schlüpfte, ließ er seine Kollegin, deren Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit er über alles schätzte, nicht einen Moment aus den Augen. Mit einer endgültigen Handbewegung legte er ihr den Brief in den Schoß. „Da! Überleg es dir bis morgen. Ich muss jetzt raus zu Luden Ladehoff und seinen Rindviechern. Die angefahrene Blattsilage ist gefroren.“ In der Tür drehte sich Poltrin noch einmal um. „Und fang schon immer mit dem Übersetzen an. Bei ,INTERTEXT‘ dauert es mir zu lange.“ Weg war er.
Maria saß wie festgeleimt. „Er traut es mir zu“, flüsterte sie, „er traut mir diese Arbeit zu.“ Und plötzlich empfand sie — stärker als alle Bedenken — den Wunsch, nicht nur diesen einen Brief aus der russischen Sprache zu übersetzen. Diese Herausforderung anzunehmen, sich zu erproben konnte Freude machen.“
Ebenfalls einen Rückblick in DDR-Zeiten, aber auf ganz andere Weise bietet das erstmals 2000 von Jutta Schlott im Wiesenburg Verlag Schweinfurth veröffentlichte Buch „Ich sah etwas, was du nicht siehst. Erinnerungen aus Ostdeutschland“: 16 Biografien verschiedenartigster Menschen aus der DDR: Eine Adlige, ein Lehrer, ein Auszubildender, eine Russin, ein Literaturwissenschaftler, eine finnische Regisseurin, ein Maschinenschlosser, ein Kulturminister, eine Heimerzieherin, ein Heimkind, eine Säuglingsschwester, ein Kantor ... „Ich sah etwas, was du nicht siehst“ wurde gefördert „durch ein dreimonatiges Stipendium des Landes Brandenburg und durch praktische Unterstützung von Frau und Herrn Rennau, Altdöbern“, wie die Autorin in einer Vorbemerkung schreibt. Und hier ein Auszug aus der zweiten der insgesamt sechzehn ostdeutschen, DDR-Biographien:
„SECHZEHN TST KEIN ALTER, WO MAN SCHON EIN HELD SEIN KANN
Sascha
Meine Mutter ist Organistin. Musik gehörte einfach zum Alltag, das hat mich geprägt. Zuallererst, als kleiner Junge, hab ich Klavierspielen gelernt und sämtliche Flöten durchgetestet; später Gitarre, die spiel ich heute noch. Mein Vater hatte in seiner Jugend die eigene musikalische Ausbildung vernachlässigt und spürte deshalb später permanenten Nachholebedarf. Zu Hause - das kann man schon eine musikalische Atmosphäre nennen, wir Kinder haben alle ein Instrument erlernt, Stücke einstudiert. In der Familie wurde zusammen gespielt, ausschließlich klassische Musik.
Zurzeit versuch’ ich mich als Gitarrist in einer Band. Ich singe auch. Wir probieren verschiedenste Stile durch, trotzdem finde ich diese Art, Musik zu machen, nicht vollständig befriedigend. Mitunter setzt sich die klassische Erziehung wieder durch. Die Arbeit mit der Band gehört zu meinem Leben einfach dazu. Bei jedem Auftritt muss man sich beweisen, muss das letzte aus sich raus holen, gleichzeitig ist man einem harten Wettbewerb ausgesetzt - damit hab ich so meine Schwierigkeiten. Gleichzeitig merke ich an mir das Bedürfnis, mich dieser Anspannung doch zu stellen.
Mein erlernter Beruf hat mit Musik gar nichts zu tun. Gleich nach der Schule hab ich eine Lehre als Landschaftsgärtner angefangen. Die praktische Ausbildung lief in Schwerin, das Theoretische in einem Dorf bei Neustrelitz, immer turnusweise. Landschaftsgärtner war wirklich kein Beruf, den ich wollte. Dass ich bei einer Lehre, zu der ich kein Fünkchen Lust verspürte, trotzdem angetanzt bin, ergab sich aus einem völlig anderen Problem: Mein Vater war auch in der Kirche tätig, hat aber Ende der achtziger Jahre den Dienst quittiert. Es gab Auseinandersetzungen, Probleme - was Konkretes wurde vor uns Kindern nicht ausgesprochen. Jedenfalls ist mein Vater mit dem ganzen Laden nicht klargekommen.
Er behauptet, dass es an seiner Haltung zu „Kirche im Sozialismus“ lag; dafür war er nicht der Typ, innerhalb der Kirche für den Staat Politik zu machen. Der Job war ja nicht irgendeine Stelle, er saß auf ’ner richtigen Position. Sein Hinschmeißen hat die Leute in zwei Lager gespalten: Entweder - oder! Sie hassen oder sie lieben ihn. Niemand hatte ihn rausgeschmissen. Er hat einfach seinen Mantel an den besagten Nagel gehängt und sich verdrückt. Sein Fall hat bei Kirchens mächtig Wellen geschlagen. Die oberen Etagen sind noch heute stinksauer auf meinen Alten.
Gleich nach dem ganzen Trouble hat mein Vater einen Ausreiseantrag gestellt. 1987, im selben Jahr, als ich mit der Lehre anfing. Sein Antrag wurde merkwürdigerweise schnell entschieden, innerhalb von einem Vierteljahr. Meine Eltern lagen damals in Scheidung. Ich nehme an, dass mein Vater auch raus wollte, um alle Brücken hinter sich abzubrechen. Die Kirche ist oft ein sehr enger Kreis gewesen.
Jedes berufliche Problem zog gleich ein privates nach sich. Mit der Scheidung meiner Eltern hab ich gerechnet, die bahnte sich seit Jahren an. Im Grunde genommen war's gut, dass Ruhe einkehrte, dass ein Schlussstrich gezogen wurde. Was das für mich bedeutete, hab ich damals verdrängt. Auch die Tatsache, dass mein Vater in den Westen ausgereist ist. Beneidet hab ich ihn nicht. Wenn man mal von Reisefreiheit absieht, reizte der Westen mich nicht.
Die Ausreise und der Umstand, dass ich nicht in der FDJ war, haben wohl dazu geführt, dass mein Antrag, das Abitur zu machen, negativ beantwortet wurde. Manche durften mit wesentlich schlechteren Noten zur EOS. Ich ging auf die Gerhart-Hauptmann-Schule, einer der Lehrer hatte mir Anfang der 10. Klasse versprochen: Sie kommen nicht zur Oberschule! Dafür werden wir sorgen. Das Versprechen haben sie eingelöst.“
Die beiden nächsten Bücher stammen von der Psychologin und Schriftstellerin Helga Schubert. Die Druckausgabe von „Das gesprungene Herz. Leben im Gegensatz“ war erstmals 1995 im Deutschen Taschenbuchverlag (dtv) München verlegt worden. Das Titelbild dieses E-Books gestaltete Ernst Franta unter Verwendung des Bildes „Winterliches Abendlicht“ von Johannes Helm aus dem Jahre 2004. Der Ex-Psychologieprofessor und Schriftsteller Johannes Helm ist der Mann von Helga Schubert.
„Das gesprungene Herz“ versammelt 22 Texte der Autorin und Psychologin, die hier wieder ganz zu ihrem poetisch-lakonischen Ton zurück gefunden hat, nachdem sie in der sogenannten Wendezeit Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches in Berlin war und der Versuchung widerstand, in die aktive Politik zu gehen. Das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt (heute: Chrismon) hatte Helga Schubert gebeten, fünfseitige Essays nach eigenen Themen über das Leben in der Nach-DDR-Zeit zu schreiben. So entsteht ein facettenreiches Bild von wunderbaren verfallenen Kirchen, von Menschen, die sich von Demütigungen erholen, von dem langsam aufmerksameren Blick zu ausländischen Mitbürgern, zu Gefährdungen der offenen Gesellschaft. Das Buch enthält auch eine literarische Predigt zu Saulus-Paulus und die Rede in der Lutherstadt Wittenberg zu Luther als DDR-Bürger, die Helga Schubert vor den verblüfften und dann amüsierten Honoratioren der Stadt hielt. In der Titelerzählung über das gesprungene Herz schreibt sie: Es ist noch genug Kraft übrig und genug Zeit für ein zweites Leben. Eigentlich wieder ein Mutmach-Buch. Und hier ist diese Titelerzählung als Angebot zum Selber-Lesen:
„Das gesprungene Herz
Ich habe ein gesprungenes Glas-Herz und schreibe, um ein Märchen zu beweisen. Das Märchen von der Prinzessin mit dem gesprungenen Herzen hat mein ganzes Leben beeinflusst. Ich habe mich schon öfter danach erkundigt, wer es noch kennt. Aber im vorigen Monat in Magdeburg passierte es zum ersten Mal nach einer Lesung, dass ein etwa gleichaltriger Mann wusste, wovon ich redete. Er wollte es zu Hause heraussuchen und mir dann schicken. Es ist das hoffnungsvollste Märchen. Aber ich weiß nicht einmal genau, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es in einem dunkelblauen quadratischen Pappeinband das zweite in einer Sammlung mit dem Namen „Träumereien an französischen Kaminen“ war, geschrieben von Richard von Volkmann-Leander. Das Buch ist verschwunden und das Märchen auch.
Sogar in einer Märchensammlung, die ich von ihm kaufte, >Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und vom König, der nicht das Brummeisen spielen konnte>, suchte ich es vergeblich. In meiner Erinnerung handelt es von einer Prinzessin, deren Herz aus Glas einen fast tödlichen Sprung bekommen hat, und ihrem Vater, der sie trotzdem gern glücklich verheiraten möchte. Er macht die Sache bekannt, viele Prinzen bewerben sich, denn natürlich wird die Prinzessin ziemlich viel erben. Die Prinzessin bekommt den freundlichsten und behutsamsten Mann, nämlich den Prinzen mit den Samthandschuhen. Wie sich denken lässt, lebten die beiden glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber ich glaube, der Prinz war arm.
Wenn man von einer Prinzessin überzeugend vorgeführt bekommt, dass es viel Wichtigeres gibt als Geld, erleichtert das die Lebensentscheidungen in Liebe und Beruf sehr. Nichts kann dann nämlich von den fehlenden Samthandschuhen ablenken. Die Samthandschuhe sind das wichtigste. Und die feste Überzeugung, dass es immer eine Rettung gibt, auch wenn etwas fast zerstört worden ist: Ich hatte aus einem Avokadostein eine Pflanze gezogen. Eines Tages verlor sie alle Blätter und stand nur noch als 50 cm hoher Strunk da. Ich beschloss, diesen Strunk als Stütze für eine haltlose, verschwenderisch ihre Ableger um sich herum verstreuende Goetheblume zu nehmen und pflanzte die Goetheblume neben den Strunk in den großen Topf, in den viel zu großen Avokadotopf - ich hatte mir ein Einpflanzen ersparen wollen. Liid nun waren die Wurzeln vermutlich gar nicht bis an den Topfrand gelangt. Ich band die Goetheblume um den Strunk. Sie verbrauchte viel Wasser, gedieh, blühte, und nach einem Jahr sah ich am Strunk ein Blatt. Die beiden lebten ein paar Jahre friedlich in einem Topf, bis er ihnen zu eng wurde. Jetzt habe ich sie zusammen in einen sehr großen gepflanzt, denn die Avokadopflanze ist fast schon ein Baum. Er gibt der Goetheblume, die Hitze eigentlich nicht mag, Schatten. Sie trinkt jeden Tag einen Liter Wasser, und durch ihre vielen Hundert Ableger sind die Avokadowurzeln geschützt und immer feucht, wie in einem Moosbett. Im Sommer schiebe ich sie zusammen in die Sonne nach draußen wie Philemon und Baucis. Und alles nur, um mir meine Hoffnung zu erhalten.
1980, ich war 40 Jahre alt, sagte der Leiter der Ehe-Familien-Jugend- und Sexualberatungsstelle Berlin Mitte beim Einstellungsgespräch zu mir: Wissen Sie, es ist gut, dass Sie in zweiter Ehe verheiratet sind. Der Familienrichterin, der Gynäkologin und ihm gehe es genauso. Ein Ratsuchender spüre einfach bei solchen wie uns, und damit meinte er auch mich, dass sein Gegenüber Katastrophenerfahrung hat und trotzdem den Mut behielt, man könne es auch Humor nennen.
Diese Geschichte hätte so schön enden können, sogar mit einer Moral, wenn nicht heute mit der Post das richtige Märchen angekommen wäre. Das richtige Märchen in der vollständigen Sammlung. Ich las es mit wachsender Bestürzung: Es ist nicht das zweite, sondern das achte in der Sammlung, und es heißt: >Die drei Schwestern mit den gläsernen Herzen<. Das schlimmste ist nicht, dass, wie schon der Titel sagt, alle drei Schwestern (immerhin sind es wenigstens Prinzessinnen) ein Glasherz haben, nein, die älteste stirbt sogar daran.
Das hatte ich ganz vergessen: Trotz der Warnung der Mutter, vorsichtig zu sein, lehnt sie sich beim Betrachten der Levkojen zu sehr auf die Fensterbrüstung, bricht ihr Herz und fällt tot um. Die zweite Tochter bekommt einen Sprung ins Herz, als sie zu heißen Kaffee trinkt. Sie wird ebenfalls nicht die Hauptperson, sondern bleibt die liebe unverheiratete Tante für die Kinder ihrer jüngsten Schwester. Diese jüngste Königstochter behält das ganze Märchen hindurch bis ans selige Ende ihr unbeschädigtes Glasherz. Und das hängt, da stimmt mein Märchen in der Erinnerung wieder, mit ihrem Mann zusammen. Aber der ist kein Prinz, sondern war nur ein Edelknabe am Hofe, der ihr dreimal die Schleppe tragen musste, um Edelmann zu werden. Dabei gefällt er ihr so gut, dass sie ihm den Tipp gibt, Glaser und König zu werden. Denn das sind die Bedingungen ihres Vaters für ihren künftigen Ehemann. König kann er nicht werden, aber Glaser. Er lernt vier Jahre das Handwerk, kehrt zu ihr zurück, und weil sie ihn in angenehmer Erinnerung behielt und weil er Samtpatschen hat, also keine Handschuhe, sondern wirkliche Samthände, und weil sich kein König findet, der auch noch Glaser ist, gibt sich der König schließlich auch mit ihm als Schwiegersohn zufrieden.
Das falsch erinnerte Märchen hat mich ein Leben lang getröstet; Es geht weiter, oder: es geht trotzdem, habe ich nach einer Kränkung oder einer Operation oder einer schweren Krankheit oder einem Tod gedacht. Und wenn so viele Gleichaltrige nach dem Ende der DDR traurig sagten, es ist zu spät, das Ende kam zu spät, ich bin zu alt zum Reisen, zu alt, um noch einmal neu anzufangen, habe ich immer an das gesprungene Herz gedacht und gesagt, besser spät als nie, man muss ja nicht unbedingt noch zu zweit mit einem Boot über den Atlantik segeln oder über das Mittelmeer auf einem Surfbrett fliegen, mir reicht schon die endlich offene Welt. Es ist noch genug Kraft übrig und genug Zeit für ein zweites Leben. Und dann haben mich die andern immer skeptisch und ungläubig angesehen.
Wie schön, dass es fast ein halbes Jahrhundert verschollen war. Denn erst heute kann ich das echte Märchen ertragen.
Ebenfalls von Helga Schubert stammt „Die Andersdenkende“. Die Druckausgabe erschien erstmals 1994 ebenfalls beim Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) München. Und auch das Titelbild dieses E-Books gestaltete Ernst Franta unter Verwendung eines Bildes von Johannes Helm, dem Ex-Psychologieprofessor, Schriftsteller und Mann von Helga Schubert. Diesmal handelt es sich um sein 1991 entstandenes Bild „Brennende Stadt“.
„Die Andersdenkende“ vereinigt 29 Erzählungen und Reden der Autorin, die die Zeit vor und nach der friedlichen Revolution zum Gegenstand haben. Helga Schubert veröffentlicht Texte, die in der DDR keine Druckerlaubnis erhielten, Auszüge aus der Beobachtungsakte des Ministeriums für Staatssicherheit über sie, die absurden Vorgänge hinter den Kulissen des Schriftstellerverbandes, die ihr die Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt verboten, aber auch das erste Klassentreffen der Abi-Klasse von 1957, nun nach 33 Jahren im vereinigten Deutschland, denn die Hälfte war in den Westen gegangen. Zum Schluss steht ein Vortrag, den Helga Schubert 1993 in der Humboldt-Uni hielt, im Institut für Neueste Geschichte: Vom Wir zum Ich - Diktaturfolgen bei den Siegern der Geschichte. Das ist ein ironisch-erleichterter Abgesang. Und hier gleich der erste der insgesamt 29 Texte von Helga Schubert:
DIE FLUGZEUGENTFÜHRUNG (1972)
Sie saß mit ihrem Kind ganz vorn im Flugzeug, direkt hinter dem Vorhang, dahinter die Piloten. Wo werden wir uns das nächste Mal treffen, dachte sie. Schwarzes Meer, Prag, jetzt Polen. Hat das eine Zukunft? Das Gespräch heute beim Abschied auf dem Flughafen Warschau: Er wollte nicht zu ihr, sie konnte nicht zu ihm. Als ob sie seine Lippen an ihrem Hals noch spürte. Ein Mann ging hinter den Vorhang. Ein leiser Wortwechsel. Tempelhof, fremde Sprache. An den Stimmen erkannte sie, dass es ernst war.
Wir werden also entweder abstürzen oder in Westberlin landen. Sie sah ihr Kind an. Das sah aus dem Fenster. Die Nachbarn unterhielten sich lachend, einige schliefen, rauchten, lasen. Der Mann gegenüber sah sie nachdenklich an, dann fragte er, ob ihr schlecht sei, blieb immer bei ihr, auch später auf dem Flugplatz. Ein großes Gelächter erhob sich im Flugzeug, nachdem sie gelandet waren: Tempelhof, hier dreht die DEFA. Als die Gangway herangerollt war und ein amerikanischer Offizier das Flugzeug betrat, öffnete sich auch der Vorhang, und der Mann mit der Waffe kam zusammen mit dem Piloten heraus.
Ich steige hier aus. Wer noch in Westberlin bleiben will, kann mitkommen, sagte er. Aber sie mussten sowieso alle aussteigen. Wurden in das Restaurant geleitet. Amerikanische Soldaten zur Bewachung. Sie befinden sich auf Westberliner Boden und werden von hier nach Ostberlin gebracht. Wer will, kann hier bleiben. Einige standen auf, ein junges Mädchen lief wie ein Tier im Raum herum. Seife und Strumpfhosen wurden verteilt, Bananen für die Kinder und Underberg für die Erwachsenen. Wer wollte, bekam eine Verpackungstüte mit Aufschrift.
Die Entführung des Flugzeugs war schon von allen Nachrichtenagenturen gemeldet worden. Er weiß es jetzt auch, dachte sie. Er brauchte hier nur anzurufen. Zu ihm könnte sie sofort, überallhin. Wer zur Toilette oder zur medizinischen Betreuung möchte, bitte melden. Es begleitet Sie ein Soldat. Sie meldete sich zur medizinischen Betreuung. Ein junger Mann saß da. Vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben, sagte er freundlich. Wollen Sie eine Beruhigungstablette? Stehen Sie vor einer Entscheidung? Einfach ist es bei uns auch nicht. Ich warte zum Beispiel schon das dritte Jahr auf einen Studienplatz Medizin. Alles hinter mir lassen, das könnte ich nicht. Haben Sie Ihren Mann dort? Nein, er ist nicht mein Mann, aber er lebt im Westen.
Ich habe mein Kind bei mir, sagte sie. Sie atmete auf, kein vorwurfsvolles Schweigen, keine Versuchung. Dann werde ich mal wieder gehen, sagte sie. Sie gab ihm die Hand. Als sie zurückkam, sprach gerade ein Westberliner Beamter zu den Fluggästen aus der DDR: Ein Westberliner Bus wird Sie und Ihr Gepäck zur Grenze bringen. Von dort werden Sie zu Fuß über die Grenze gehen und dort mit einem DDR-Bus abgeholt. Aber weil Sie nun schon mal in Westberlin sind, möchten wir mit Ihnen eine Stadtrundfahrt machen. Einige forderten ihre sofortige Rückführung mit einem Flugzeug, einige wollten keinen Umweg, aber einige stimmten zu. Das war die Mehrheit.
Sie musste wieder erbrechen und lief auf die Toilette. Als sie zurückkam, sagte der Beamte gerade, dass der Bus jederzeit anhalten könne, wenn jemand im Westen bleiben möchte. Sie könnten es sich noch bis zur Grenze überlegen. Sie musste wieder an ihn denken: Jetzt weiß er es ganz bestimmt, dass ich im Westen bin. Einige Nachrichtenstationen müssen es gemeldet haben, er weiß es. Wenn er wollte, wenn er wirklich wollte, dass wir zusammenleben, er würde mir eine Nachricht geben, Sie bestiegen den Bus. Viele aßen Südfrüchte. Die Kinder Kaubonbons. Die Geschäftsauslagen waren zum Greifen nah. Bald fuhren sie über den Kurfürstendamm, langsam auf der Außenspur.
Ihr Kind sagte, dass hier überall, ohne dass man ihn sieht, der Feind wohnt, Sie überlegte, wo sie mit dem Kind allein sprechen könnte. Hier kann man auch leben, sagte sie zu ihrem Kind, leise und forschend. Das Kind sah sie erschrocken an: Du kannst hierbleiben, ich will nach Hause, flüsterte es ihr ins Ohr. Die wollen uns alle verderben, sagte es, achtjährig. Sie fuhren auch durch die Türkenviertel, an den Geschäften vorbei mit den unaussprechbaren Namen, den Parolen an den Wänden, den vielen dunkelhaarigen Jungen an den Ecken, zusammenhockend. Im Bus lachten viele, zeigten sich die Kinos ihrer Jugend, die Kneipen der Studentenzeit, die billigen Geschäfte von damals und, wo die Wechselstuben standen. Wie in einem Farbfilm über Westberlin, nicht?
Ein paar aus dem Flugzeug fehlten im Bus: das junge Mädchen, ein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, auch die blonde Frau, die zum Entführer gehörte. Komm, du musst sicher mal, sagte sie zu ihrem Kind, als sie am letzten Haus vor der Grenze standen, nur noch ein paar Schritte entfernt, Nein. Doch, doch, Das Kind kam mir ihr in das Haus. Dort konnte sie sich ungestört mit ihm unterhalten. Nun war alles klar.
Draußen warteten schon die Fotoreporter. Über die Grenze gingen sie schweigend. Ihr Kind griff nach ihrer Hand. Die wortlosen Grenzsoldaten. Die Befragung durch die Sicherheitsorgane der DDR begann noch am gleichen Nachmittag und war gründlich. Warum hatte sie nicht gleich alle im Flugzeug verständigt, als sie das Wort „Tempelhof“ und den heftigen Aufschlag gehört hatte? So hätte man doch den Entführer noch auf dem Territorium der DDR überwältigen können? Allein war die polnische Crew doch machtlos? Ich wollte, dass alle weiterleben, antwortete sie. Und hatte sie eigentlich daran gedacht, im Westen zu bleiben? Sie stellte doch in letzter Zeit häufig Anträge auf Einreisevisum für einen Mann aus dem westlichen Ausland? Daraus könne man doch entnehmen, dass sie nähere Beziehungen zu ihm unterhalte? Warum war sie nicht im Westen geblieben? Sie versuchte sich zu entschuldigen; Ihre Freunde und ihre Arbeit und ihr Fernstudium kurz vor dem Abschluss und die Entwicklung ihres Kindes.
Der Staatssicherheitsoffizier blieb skeptisch. Das Kind hatte während der Befragung einige Stunden ruhig vor der Tür gesessen, nur einmal um eine Brause gebeten. Sie kamen erst nachts nach Haus. An der Tür fand sie einen Zettel von einem jungen Ehepaar aus dem Haus: „Bitte komm doch gleich zu uns, auch wenn es schon Nacht ist.“ Sie wussten es also auch, dachte sie. Und nahmen an, dass ich zurückkomme. Sie brachte ihr Kind ins Bett und sagte ihm, dass sie noch zu den Freunden geht. Es war einverstanden, dann schlief es ein. Die Verhöre dauerten die nächsten Wochen an. Von ihm hörte sie nichts mehr.“
Der letzte der fünf Deals dieser Woche spielt zwar auch in der DDR, ist aber einem ganz anderen Genre als die anderen vier zuzurechnen. Es ist ein Krimi. Der Kriminalroman „Tantalus“ von Heinz Kruschel erschien erstmals 1985 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig: Die Legende erzählt von Tantalus, der die Götter versuchte. Sie straften ihn mit den sprichwörtlich gewordenen Tantalusqualen: Er leidet Hunger und Durst angesichts der verführerischsten Labsale. Heinz Kruschel erzählt in seinem ersten Kriminalroman von einem, der tötete, weil er seine Sehnsucht stillen wollte. Alles beginnt wie in einem richtigen Kriminalroman: Ein Toter wird aufgefunden. Doch es wird niemand vermisst. Ist der Tote Adolf Peters? Aber der schrieb Karten von jenseits der Grenze. Und wer hätte ein Motiv gehabt, ihn zu töten? Die attraktive, tüchtige Sonja Peters? Ihr erster Mann, der Architekt Thunberg? Sonjas Tochter Ute? Und Gerald, Utes Freund, ständiger Gast der Peters? Ein fremder Mann besuchte Peters im Wohnheim. Die Inventur in Sonjas Kiosk brachte Unregelmäßigkeiten ans Licht. Vielleicht hatte Peters mit dem Betrug zu tun. Hauptmann Korsar und sein Mitarbeiter Franz klären den Fall auf. Für den Täter beginnen Tantalusqualen ...
Nicht nur ein Kriminalfall wird in diesem Roman aufgeklärt, sondern in Lebensgeschichten werden die psychologischen Bedingungen des Verbrechens erhellt. Das Buch von Heinz Kruschel beginnt mit einer grausigen Entdeckung:
„DER FUND
Die beiden Jungen verließen den zugefrorenen Tümpel, nachdem sie lange Schlittschuh gelaufen waren. Überall lag dicker Raureif. Der Weg, auf dem sie liefen, war hart gefroren. Zu gleicher Zeit nahmen sie den Geruch wahr. „Ein Tier. Ein Tier, das krepiert ist.“ „Oder geschlagen von einem Bussard.“ Dann sahen sie den Schädel, wenige Meter vom Pfad entfernt. Er steckte, gelblich und kuglig, im aufgekratzten Erdreich. Sie schluckten und schwiegen und sahen sich endlich an. „Das ist kein Tier.“ „Nein. Das ist, das ist ein Schädel.“ „Rühre nichts an.“ Das Gras stand weiß, steif und glitzernd. Die Luft war klar. Es war schon zu kalt für den ersten Schnee. „Reiß dich zusammen.“ „Ja doch. Mir ist aber schlecht.“
Einer brach Zweige ab und legte sie über Kreuz: von dem Wege, den sie gelaufen waren, bis zu der Stelle, wo der runde Schädel steckte. Der andere kam nicht näher. Sie sprachen wenig und erschraken, als schwarze Krähen langsam und fast lautlos aufstiegen. Der Lienhut klirrte gläsern. Seine vereisten Zweige schlugen aneinander. Sie liefen los, wie einem Befehl folgend, sie liefen den Kirchsteig hinunter, als könnten sie keine Minute länger warten. Manchmal strauchelten sie und fielen hin, kamen aber schnell wieder hoch und liefen weiter. Sie liefen so schnell, als gelte es, Abstand zu einem Verfolger zu gewinnen. Wortlos und heftig atmend wandten sie sich noch einmal um, bevor sie durch den Tunnel gingen, sie blickten hinauf zum Lienhut.
Sie trafen den Bürgermeister vor der Schenke. Er redete mit einigen Männern in Arbeitskleidung, weil die Schneepflüge noch immer defekt und für den nahen Winter nicht einsatzbereit waren. Den Jungen aber hörte er gleich zu, weil er ihnen das Entsetzen ansah. Er hörte zu und sagte: „Es gibt viele Wildschweine dieses Jahr, es wird ein Tierschädel sein.“ „Ein Wildschwein hat vielleicht den Schädel frei gescharrt, das kann sein.“ „Ihr meint wirklich, da ist ein Mensch vergraben?“ Sie nickten. Ein Mensch vergraben — das klang ungeheuerlich. Der Bürgermeister ging, wichtig und schwer, in die Gaststube, um mit der Polizei zu telefonieren. Die Jungen folgten ihm und setzten sich an einen Tisch, gleich neben den großen Kachelofen.
Die Wirtin hatte mitgehört und braute ihnen einen Grog. „Beim Lienhut, sagt ihr?“ Die Jungen nickten, sie zitterten noch und legten ihre Hände um die Gläser. „Es wird ein Tier sein“, sagte die Frau, „hier passiert nichts. Man kann seine Tür auflassen, man braucht kein Auto abzuschließen. Hier wird nicht mal ein Kaninchen gestohlen, drüben im Badeort, übern Berg, ist das anders, aber hier. Am Lienhut soll mal ein Mann seine Töchter und sich selber in die Glut des Ofens gestürzt haben. Das ist Märchen.“ Die Jungen kannten die Geschichte nicht. „Man erzählt, er besaß viel Silber und konnte Eisen gewinnen, man sieht ja noch Reste von Grundmauern im Brombeergestrüpp, dort hat mal ein Eisenhammer gestanden. Die beiden Töchter sollen freundlich und naiv gewesen sein, Dummerchen, die eines schönen Tages fahrenden Händlern alles weiße Eisen verkauften, denn sie wussten ja nicht, dass es Silber war. Sie wussten überhaupt nicht, dass es Silber gab. Der Vater hat sie, als er zurückkehrte, in die Glut des Ofens gestürzt, in seinem Jähzorn, in seiner Wut, und gleich darauf sich selber, denn die Töchter, die er getötet hatte, waren ihm das Liebste gewesen, nicht das weiße Eisen.“ „Wann soll das gewesen sein?“ „Vor Hunderten von Jahren. Oder vor tausend schon, wer weiß.“
Nach einer halben Stunde kam der Wagen der Kriminalpolizei aus der Bezirksstadt. Der Major, der die Morduntersuchungskommission leitete, hieß Korsar, ein älterer Mann mit breiter Brust und starken Schultern. Er hatte ein braunes Gesicht mit einer fleischigen Nase und einen kleinen Mund. Bei diesem Wetter, das den Winter ankündigte, spürte er eine alte Unfallverletzung an den Knien wie ein Rheumakranker sein Leiden. Und nun der mühselige Weg den Kirchsteig hinauf. Die Jungen gingen den Kriminalisten voraus, ihnen war warm vom Grog und schon wieder übel vor dem, was sie gleich wiedersehen würden. Nur ein jüngerer Mann, der sich mit >Franz< vorgestellt hatte, blieb an ihrer Seite. Franz war ein trainierter Mann, das merkten sie.“
Ob Major Korsar und Franz herausfinden, was tatsächlich passiert ist und warum und wer der Mörder war? Sie jedenfalls können es herausfinden, wenn Sie den Kriminalroman „Tantalus“ lesen, der eigentlich mehr ist als ein Kriminalroman. Autor Heinz Kruschel will auch psychologische Hintergründe und Zusammenhänge deutlich machen. Etwas ganz Ähnliches gelingt auch der studierten Psychologin und Schriftstellerin Helga Schubert, die ebenso wie ihre beiden Schriftstellerkolleginnen Jutta Schlott und Barbara Kühl Lebensgeschichten erzählt. Und gibt es eigentlich Spannenderes als Lebensgeschichten? Viel Vergnügen, Spannung und Unterhaltung bei der Lektüre der Angebote des aktuellen Newsletters. Und einen schönen Feiertag!