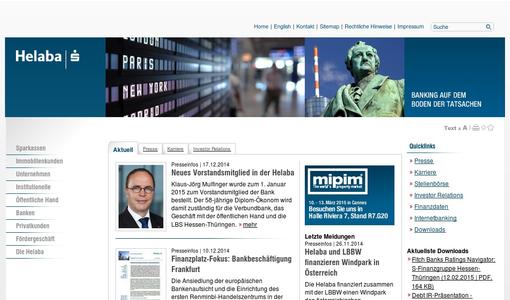In Griechenland sieht es etwas anders aus. Während der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras im Wahlkampf noch versuchte, mit einem Grexit zu drohen, hat sich seine Rhetorik massiv geändert nachdem klar wurde, dass die anderen Eurozonenländer sich davor nicht mehr zu fürchten scheinen.
Ich hatte bereits 2012 darauf hingewiesen, dass ein Grexit nicht das Ende des Euro bedeuten würde - ganz im Gegenteil. Dies gilt heute umso mehr. Der Verlust des Wechselkurses als Anpassungsinstrument erfordert eine höhere interne Flexibilität zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Auch war bereits bei der Bildung der Europäischen Währungsunion klar, dass ausufernde Haushaltsdefizite eines Landes negative externe Effekte für die anderen Länder bedeuten würden und somit die Währungsunion in der Summe belasten. Genau aus diesem Grund wurden in den Maastricht-Verträgen Fiskalgrenzen eingezogen. Ihre Effektivität war aber von Anfang an begrenzt. Der politische Wille zur strikten Einhaltung der Maastricht-Kriterien war nie wirklich vorhanden. Die in den ersten Jahren noch als unumstößlich beworbene "no-bail-out-Klausel" kam letztendlich auch noch unter die Räder. Notwendige, aber erst mittelfristige Strukturreformen wurden durch kurzfristige Transfers ersetzt. Der Anreiz, die eigenen Probleme selbst zu lösen, ging damit in manchen Ländern zurück.
Nicht die fehlende Fiskalunion, sondern der mangelnde Wille, eine ausufernde Fiskalpolitik der einzelnen Länder zu unterbinden, ist der entscheidende Geburtsfehler der Europäischen Währungsunion. Zudem wurde versäumt, sogenannte Exit-Klauseln in das Vertragswerk einzubauen.
In Griechenland wird offensichtlich, dass sich das Land nicht mehr den Regeln einer Währungsunion unterwerfen will. Auch hilft es Griechenland wenig, dass der Euro abgewertet hat. Die Wettbewerbsposition gegenüber den anderen Eurozonenländern bleibt dabei unverändert. Entsprechend müssten die internen Anpassungsinstrumente umso stärker genutzt werden. Das heißt nichts anderes, als dass Löhne und Preise weiter sinken müssten. Tsipras möchte aber gerade diesen begonnenen Weg wieder umkehren und hat höhere Mindestlöhne und andere soziale Wohltaten versprochen. Strukturreformen und Auflagen für die notwendigen Hilfskredite sollen abgeschafft werden. Wenn Tsipras diesen Weg gehen will, ist die einzig verbleibende Möglichkeit der Austritt aus der Währungsunion.
Es ist jedoch mehr als fraglich, ob dies wirklich der einfachere Weg ist. Denn je mehr die neue Währung - wie auch immer sie heißen mag - abwerten würde, desto höher stiege über die Importe die Inflation. Für ein Land, das mehr Lebensmittel importiert als exportiert, wären die Auswirkungen dramatisch. Inflationssteigerungen von 50 Prozent wären nicht unwahrscheinlich. Dann müssten die Nominallöhne zwar nicht gesenkt werden, die Reallohnsenkungen würden aber weit über das hinausgehen, was "die Insitutionen" derzeit den Griechen abverlangen. Die Belastungen für die Bevölkerung wären somit deutlich höher als dies jetzt der Fall ist. Soziale Unruhen, die weit über das hinausgehen, was derzeit aus Griechenland gemeldet wird, wären wahrscheinlich.
Wie würde sich der Grexit auf die Europäische Währungsunion auswirken? Muss mit einem Übergreifen auf andere Länder gerechnet werden? Ich denke nicht. Zum einen ist der Wille zur Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen in vielen Ländern deutlich höher ausgeprägt als in Griechenland. Auch ist die Ausgangslage in den anderen Ländern nicht unmittelbar vergleichbar. So erzielt Irland bereits seit geraumer Zeit wieder Außenhandelsüberschüsse. Spanien weist ebenfalls eine steigende Export- und Investitionsdynamik auf. Sollte Griechenland den Euroraum tatsächlich verlassen, dürfte dies auf den Rest der Währungsunion keine destabilisierende, sondern vielmehr eine disziplinierende Wirkung haben, die mittelfristig durchaus die wirtschaftliche Situation verbessert.
Destabilisierend würden hingegen starke Zugeständnisse an Tsipras wirken. Denn dies könnte den Reformwillen in den "Nehmerländern" schwächen und die Euroverdrossenheit in den "Geberländern" stärken.
Beitrag erschienen in "Die Welt", 14. Februar 2015